„Wir hätten da ein Problem für Sie“ oder: Ohne Use-Case kein Erfolg
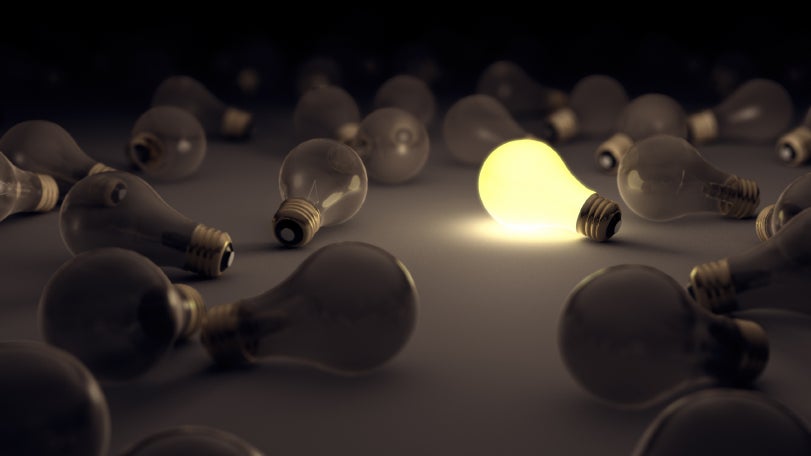
Super Produktidee gehabt? (Bild: © fpm – iStockphoto.com)
Anwendungsfall und Kundennutzen: Nicht immer vorhanden
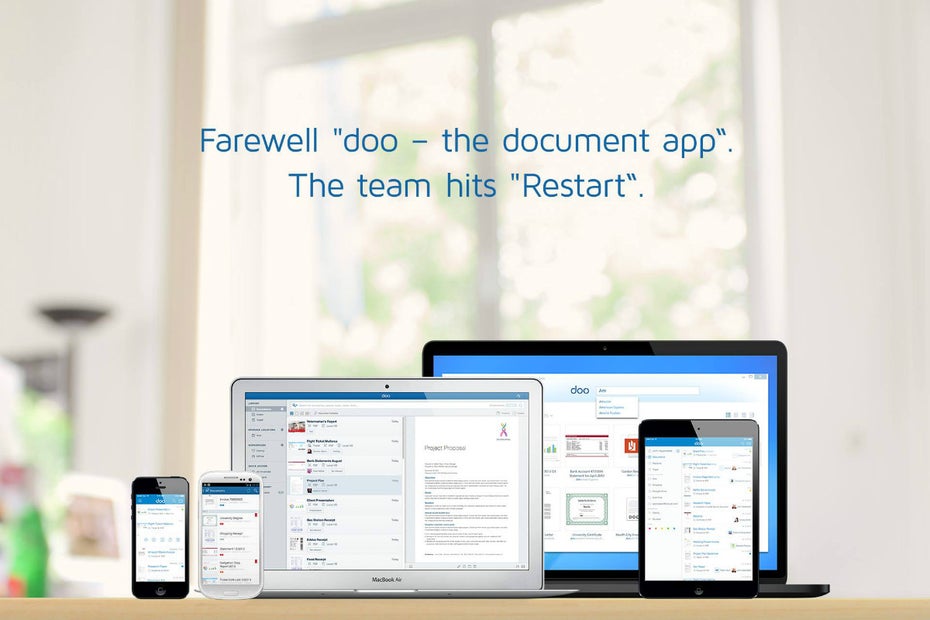
Aus der Traum vom papierlosen Büro: Dem Bonner Startup doo fehlte der Use-Case. (Bild: doo)
Als doo vor wenigen Tagen die Flügel strecken musste, habe ich manch einen „Es hat halt der Use-Case gefehlt“ sagen hören. Hinterher ist man aber immer schlauer und in der Retroperspektive lässt sich einiges erklären, so auch das Scheitern. Bei doo selbst ist man selbstkritisch und hat sich eingestanden, dass die aktiven Nutzer ausgeblieben sind. Der Traum vom papierlosem Büro sollte ein Traum bleiben, die Kunden zumindest hatten ihn anscheinend nicht. Der Use-Case – oder Anwendungsfall – war nicht ausreichend gegeben.
Dabei ist doo noch nicht mal eine Ausnahme. Mit so mancher Geschäftsidee soll ein Problem gelöst werden, das beim Anwender gar nicht existiert. Dann werden Anwendungsfälle konstruiert oder neue technologische Möglichkeiten auf nicht existente Probleme los gelassen. Es scheint im ersten Moment logisch zu sein, beispielsweise vorhandene Verträge und Dokumente zu digitalisieren, um sie leichter auffindbar zu machen. Die Frage ist nur: Wie oft braucht das der durchschnittliche Anwender? Die Entwicklungen bei doo haben gezeigt: nicht häufig genug.
Use-Case: Die Realität orientiert sich nicht an den Wünschen der Gründer
Für viele Unternehmen sind Anwender immer dann gut, wenn sie eine Produktidee lieben. Sich mit einem kritischen Publikum auseinanderzusetzen, ist weitaus schwieriger, aufwändiger und frustrierender. Schnell kommen dann Managerweisheiten auf den Tisch – wie das Henry Ford zugeschriebene Zitat „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde“. Zum einen aber hat Ford das nie gesagt und zum anderen ist das Zitat auch inhaltlich schwierig. Fälschlicherweise wird es immer wieder als Freibrief gesehen, sich nicht auf die tatsächlich existierende Kundenbedürfnisse zu fokussieren.„Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“
Gerade bei Neugründungen scheint es immer wieder darum zu gehen, möglichst viel Kapital einzusammeln und sich nur wenige Gedanken um das eigentliche Produkt zu machen. Im Business-Plan mag sich vieles gut anhören, aber die Realität orientiert sich nicht an den Wünschen der Gründer, sondern an denen der Anwender.
Anwendungsfälle sind oft zu konstruiert

Use-Case unklar: ein Kuli mit LED-Beleuchtung (Foto: t3n)
Natürlich gibt es keine Formel für Erfolg, aber es gibt beeinflussende Elemente. Neben dem Anwendungsfall, also dem Problem, das gelöst werden soll, ist der nächste wichtige Punkt die Frage, wie es gelöst wird. Idealerweise versteht der Anwender den Anwendungsfall. Besser noch: Er kann ihn nachvollziehen. Hat man mit einer Lösung ein Alleinstellungsmerkmal und bewegt sich alleine im Markt, ist das optimal. Trotzdem ist die Art und Weise, also die Frage, wie ein Problem gelöst wird, genauso wichtig wie die Lösung selbst. Genau bei diesen Punkten aber hakt es immer wieder. Anwendungsfälle sind oft zu konstruiert –die Umsetzung nicht optimal.
Als Dropbox im Jahr 2007 gestartet ist, gab es schon viele Jahre die Möglichkeit, Online-Speicher als virtuelle Festplatte, als sogenanntes Webdav, einzubinden. Dateiablage im Internet war also per se kein Problem. Dropbox hatte aber nicht den Anwendungsfall „Dateien im Internet ablegen“, sondern wollte eine einfache Möglichkeit schaffen, diese Dateien von überall zugänglich zu machen, ohne dass der Anwender etwas tun muss. Der Anwender musste Dateien nicht auf einen Server laden, sich Webspace besorgen oder sich mit Übertragungsprotokollen wie FTP auskennen. All das erledigt Dropbox automatisch, indem der Client sich ins System einbindet und kostenlosen Speicher zur Verfügung stellt. Der Anwendungsfall war klar und verständlich: Dropbox bietet eine Lösung für ein Problem und diese Lösung liegt einfach in der Hand.
Use-Case: Die Anwender sind der Schlüssel
Beliebte Mittel, um eine Idee zu verifizieren, sind Marktforschung und Umfragen. Das Problem bei Umfragen aber ist immer das gleiche: Der Befragte muss sich in die Fragen und Problemstellung hineinversetzen, wenn er nicht zufällig der Zielgruppe entspricht. So gesehen nimmt er eine Rolle ein, die nicht sein natürliches Verhalten abbildet. In eben dieser Rolle würde er das Produkt auch einsetzen. Macht er aber später nicht. Die Aussage, dass 87 Prozent die eigene Lösung nutzen würden, hilft wenig, wenn sie es dann nicht tun. Daher sind Umfragen immer zu hinterfragen.
Schlussendlich nämlich soll das Produkt von Anwendern genutzt werden. Es macht also Sinn, es auch für die Zielgruppe zu entwickeln und zu designen. User-zentrierte Methoden wie zum Beispiel Design Thinking helfen, die Probleme der Zielgruppe zu identifizieren und ein tiefes Verständnis dafür zu bekommen, wie Anwender handeln und warum sie Dinge so tun wie sie es tun. Auch, wenn es das erwähnte Henry-Ford-Zitat nicht gibt, kann man eines ableiten: Fragen alleine hilft nicht. Besser ist es, die Anwender zu beobachten und ihre Handlungen zu verstehen.
Oder, um es kurz auszudrücken: Misserfolge kann man nicht verhindern, aber man kann die Gefahren minimieren.
