Crowdsourcing: So setzt du die neue Co-Economy auch in deinem Unternehmen um

Kollaborative Wertschöpfung
[metabox keyword=“crowdsourcing“]Die Co-Economy treiben vor allem gemeinsame Ziele an: die erfolgreiche Umsetzung von Projekten, der Wunsch, Produkte mitgestalten zu dürfen, oder auch die Vorteile eines gemeinsamen und damit erweiterten Wissens- und Kreativpools. Der kollaborative Ansatz schließt dabei aber wirtschaftliche Interessen nicht aus. Oftmals schonen gemeinschaftliche Prozesse sogar Ressourcen und sind damit effizienter als autarke Ansätze. Die Co-Ökonomien lassen sich zum einen unternehmensintern nutzten: beispielsweise als Ideen- oder Prognosebörsen, bei denen die Weisheit der vielen hilft, strategische Entscheidungen abzuwägen und zu treffen; zum anderen aber auch in Form einer Kooperation mit anderen Unternehmen, Kunden oder ganz allgemein einer erweiterten Community Gleichgesinnter. Bei letzterem handelt es sich meist um Online-Marktplätze, auf denen Unternehmen Kreativ-Konzepte oder andere digitale Dienstleistungen (global) ausschreiben. Der Konsens: Wer sich dem Austausch öffnet, lernt und fördert Innovationen. Er erreicht mit seinem Produkt oder Anliegen eine weite Zielgruppe und findet Unterstützer bei der Umsetzung und Finanzierung seiner Ideen. Dennoch ist die Co-Economy kein Selbstläufer, sondern will gelenkt sein. Die Hierarchien sind zwar anders verteilt, Aufgaben und Inhalte muss man aber dennoch kuratieren. Zur grundlegenden Infrastruktur gehören dabei entsprechende Online-Netzwerke und Tools wie (digitale) Payment-Dienste. Ohne diese technischen Voraussetzungen mit entsprechend guter Usability ist eine offene Kollaboration nur bedingt möglich – oder zumindest nicht in dem heute vorhandenen Ausmaß.
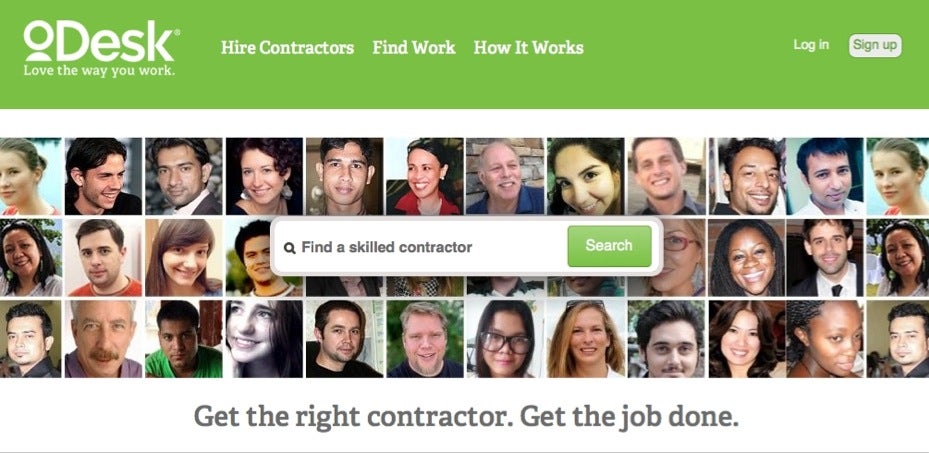
Der Crowdsourcing-Marktplatz oDesk vermittelt kreative Dienstleistungen.
Marktplätze, Kreativportale, Innovationsplattformen
Neben Crowdsourcing-Marktplätzen wie 99designs (für Logos oder Webdesign) und oDesk (für jede Art kreativer Dienstleistungen) oder Kreativportalen wie Jovoto sind es vor allem Innovationsplattformen wie Quirky oder unserAller, die eine neue Art der kollaborativen Kreation fördern: Hier entwickelt man gemeinsam Ideen für Produkte, Produktvarianten oder -verbesserungen. Bei dieser Co-Creation handelt es sich um einen strategischen Ansatz, bei dem User im Rahmen eines kollaborativen Prozesses (über die entsprechende Online-Plattform) neue Dienstleistungen, Produkte oder Ideen erschaffen. Dies hat einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Beziehung zwischen Auftraggeber und -nehmer sowie Unternehmen und Kunden, aber auch in der klassischen Wertschöpfung zur Folge. Angetrieben wird die Community durch intrinsische Motive wie die Aussicht auf Reputation, Spaß oder das Interesse am Produkt. Oder es locken extrinsische Vergütungen wie etwa ein ausgeschriebenes Preisgeld für die besten Entwürfe. Während auf den Crowdsourcing-Marktplätzen Kreative in einer offenen Infrastruktur ihre Dienstleistung gegen Stundensätze, Fixbeträge oder in Form von Pitches anbieten, nutzen Unternehmen bei den Innovationsplattformen auch geschlossene Contests, um Entwürfe diskreter und somit Konzern-konform zu behandeln. Die Rechte an den Entwürfen wechseln in allen Fällen erst nach Bestätigung beider Parteien den Besitzer, wobei die Strukturen der Plattform das Handling (etwa das Payment) abdecken. Bei offenen Ideenplattformen müssen die Unternehmen zudem ein externes (vom Unternehmen oder einer Agentur gesteuertes) Community-Management sicherstellen, um die Teilnehmer zu motivieren und zeitnahes Feedback auf die Vorschläge zu gewährleisten.
Umsetzung und Anforderungen: Mehrstufiger Review-Prozess
Wer nun solch eine Online-Community erfolgreich realisieren möchte, sollte beim Aufbau und Betrieb der Plattform einige Regeln befolgen. Die Gründerin der Plattform unserAller Catharina van Delden setzt zum Beispiel auf einen Projektaufbau in mehreren Phasen und einen mehrstufigen Review-Prozess. So sollten Vorschlags- und Abstimmungsphasen aus ihrer Sicht immer getrennt verlaufen. Im Idealfall grenzt ein nicht sichtbares Pre-Voting die Anzahl der Vorschläge im Review ein und garantiert so eine Mindestqualität. Die Community hat dabei zwar das letzte Wort, der Hersteller kann aber den Strategie- und Produktionsfit sicherstellen. „Jedes Projekt sollte wie ein gutes Brainstorming aufgebaut sein. Am Anfang werden wild Ideen gesponnen und erst danach eingegrenzt“, erklärt Catharina van Delden. „Der größte Fehler beim Crowdsourcing in der Produktentwicklung ist eine Abstimmung ohne vorheriges Review. Das wirkt dann unweigerlich so, als würde sich der Hersteller über die Community stellen“, weiß van Delden. unserAller setzt dabei vor allem auf gute Sortier-Algorithmen, die die Anzeige der Ideen während der Vorschlagsphase organisieren. Jede Idee sollte in der Vorschlagsphase die gleiche Chance haben, Unterstützer zu finden. Darüber hinaus muss auf der ersten Seite aber auch immer ein guter Mix aus Neuem sowie spannenden und guten Vorschlägen erscheinen. Zu empfehlen ist, dass der Moderator ähnliche oder gleiche Ideen beim Review zusammenfasst oder Vorschläge splittet. Zuletzt braucht man einen geschlossenen Bereich zur Ausarbeitung: Nachdem der Gewinner feststeht, sollte der Community-Dialog nämlich nicht aufhören. So wäre es sinnvoll, die Gewinner daran teilhaben zu lassen, wie ihre Ideen in das Produktkonzept dann auch tatsächlich einfließen. Bei unserAller funktioniert dies beispielsweise über ein geschlossenes Projekt, bei dem alle Gewinner einer Phase mitsprechen können.
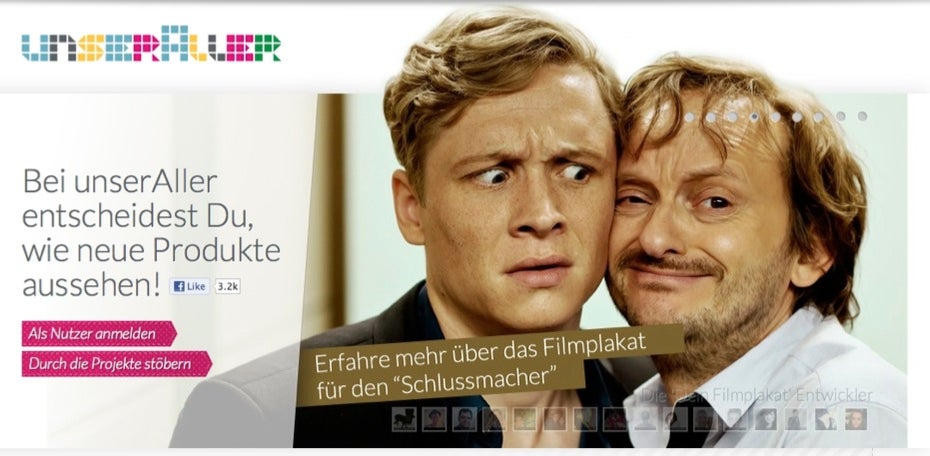
Über die Crowdsourcing-Plattform unserAller können Unternehmen ihre Community zur Co-Creation von Produkten einladen.
Kollaboration und Co-Working: Online trifft Workspace
Einen etwas anderen Ansatz verfolgen solche Modelle, die Online-Communitys mit physischen Workspaces verbinden – wie etwa das Co-Working-Netzwerk Seats2meet aus den Niederlanden. Das Geschäftsmodell baut dabei auf der „Social Currency“ – also dem Wissen, den Fähigkeiten und den Kontakten – auf, die die beteiligten Freelancer in die Community einbringen. Der Deal lautet: Registrierung auf der Online-Plattform gegen freien Workspace, Kaffee und Lunch. Diese lebendige Kreativ-Community zieht damit Firmen an, die für die Nutzung der Infrastruktur zahlen. In den USA wurde ein ähnliches Projekt vom ehemaligen Second-Life-Gründer und Verfechter virtueller Welten und Währungen Philip Rosedale ins Leben gerufen. Wer für seinen Workclub in San Francisco registriert ist, hat Zugriff auf ein Mapping-System, das Gesuche und Angebote listet: vom Print-Design über Kurierfahrten bis hin zu Spanischkursen. Ergänzend dazu gibt es eine weitere Plattform namens Worklist. Dabei handelt es sich um ein offenes Developer-Netzwerk, das Startups mit Programmierern zusammenbringt. Mit diesen unterschiedlichen Elementen will Rosedale die Zukunft der Arbeit neu definieren, in der virtuellen und der physischen Welt.

Seats2Meet verbindet On- mit Offline-Collaboration.
Fazit: Neuer Führungsstil ist gefragt
Diese Entwicklungen sind für viele Unternehmensbereiche – insbesondere aber für die innovative Projekt- und Produktentwicklung – eine der größten Veränderungen der heutigen Zeit und erfordert einen vollkommen neuen Führungsstil, der die kollaborativen Wertschöpfungsprozesse und neuen Infrastrukturen genauso kennt und berücksichtigt wie die Bedürfnisse der dazugehörigen Community.
| Positiver Effekt des kollaborativen Arbeitens | Voraussetzung |
| Flexibler Zugriff auf Ideen, Arbeitsleistungen und Kapital | Transparenz, Einfachheit und gute Usability der Plattformen |
| Besserer Umgang mit Ressourcen | Adäquates System zur fairen, zielgerichteten Entlohnung |
| Erweiterter Kreativ-Pool mit Blick über den Tellerrand | Klärung und Schutz des geistigen Eigentums |
| Größerer kreativer Freiraum für Individuen | Mehr Eigenverantwortung und -motivation des Einzelnen |
Grundsätzlich arbeiten die Individuen der Co-Economy selbstorganisierter und eigenverantwortlicher als je zuvor. Dennoch brauchen sie funktionierende Infrastrukturen, die es ihnen erlauben, zeitlich und räumlich flexibler zu arbeiten. Diese Entwicklung verlangt letztlich auch den Unternehmen einiges ab. Denn flache Hierarchien sind bei Weitem nicht mit weniger Verantwortung gleichzusetzen. Ganz im Gegenteil: Mit der Disruption bisheriger Arbeitsabläufe nimmt die Komplexität der Prozesssteuerung drastisch zu. Alle Beteiligten müssen sich in diesen neuen digitalen Technologien, Infrastrukturen und Ökosystemen positionieren und neue Prozesse bestmöglich mitgestalten.

 Claudia Pelzer ist Medien-Ökonomin, Autorin und promoviert über „neue Arbeitsformen für Kreativarbeiter“. Sie berät Unternehmen bei der strategischen Umsetzung kollaborativer Arbeits- und Geschäftsmodelle sowie Open-Innovation-Ansätze. Sie baut derzeit das
Claudia Pelzer ist Medien-Ökonomin, Autorin und promoviert über „neue Arbeitsformen für Kreativarbeiter“. Sie berät Unternehmen bei der strategischen Umsetzung kollaborativer Arbeits- und Geschäftsmodelle sowie Open-Innovation-Ansätze. Sie baut derzeit das 