- Zeitliche und örtliche Flexibilität
- Kreativer Ideenaustausch in Netzwerken und Labs
- Interne Unternehmensstrukturen verändern sich
- Mehr Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter
- Herausforderung Interne Kommunikation
- Social Media und Recruitment: Online-Reputation wird wichtiger
- Viel zu wissen, ist keine Kompetenz mehr
- Fokussierung auf das Wesentliche: Digitaler Minimalimus
- Mit der Atemlosigkeit des Netz-Lebens umgehen
- Fazit
Wie der digitale Fortschritt unsere Arbeitswelt verändert: Arbyte!
Arbyte, also das moderne Arbeiten mit Bits und Bytes, hat in den letzten Jahren nicht nur zahlreiche neue Berufsfelder hervorgebracht, deren englische Bezeichnungen kaum ins Deutsche zu übersetzen sind und die sich der eigenen Oma unmöglich erklären lassen. Der Einzug von Technik, Internet und mobilen Geräten beeinflusst auch die Art und Weise unseres Arbeitens, hat Auswirkungen auf interne Unternehmensstrukturen und darauf, wir wir an Jobs kommen.
Viele genießen die neuen Freiheiten, die sich in der „digitalen Ära“ ergeben. Sich selbstständig zu machen, ist einfacher geworden, weil internetbasiertes Arbeiten orts- und zeitunabhängig geschieht. Viele junge Freelancer lassen sich nicht einmal mehr von den lukrativen Angeboten großer Konzerne in die Festanstellung locken, sondern arbeiten lieber von zu Hause aus, wo Arbeiten und Leben miteinander verschmelzen. „Arbeit bezeichnet wieder das, was man tut, nicht wohin man geht“, fasst Ulrich Klotz, ehemaliger Vorstand der IG Metall, diese Entwicklung zusammen [1]. Natürlich birgt diese Entwicklung auch Herausforderungen und Gefahren. Am besten scheint es denjenigen zu gehen, die sich auf die neuen Strukturen einlassen, das Beste für sich herausziehen und sich an manchen Stellen bewusst abgrenzen.
Zeitliche und örtliche Flexibilität
Wenn Arbeit hauptsächlich mit mobilen technischen Geräten und online erledigt wird, verlieren Zeit- und Raumkomponenten zunehmend an Bedeutung. Dies ermöglicht ganz neue Arbeitsweisen und die Möglichkeit, sich neben einem festen Job eine Selbstständigkeit aufzubauen. Was von vielen genutzt wird: In den letzten Jahren hat in Deutschland vor allem die Zahl der Menschen, die sich im Nebenerwerb selbstständig machen, stark zugenommen.
Diese neue Flexibilität lockt nicht nur Freiberufler. Auch in einem Unternehmen zu arbeiten, bedeutet nicht mehr unbedingt, sich jeden Tag zusammen im Büro einzufinden und vor Ort das obligatorische Montags-Meeting abzuhalten. Immer mehr Firmen ermöglichen ihren Angestellten, individuelle Programme zu fahren: Homeworking-Days, Teilzeit-Anstellungen und sogar das Arbeiten in Coworking Spaces gehören zur neuen Arbeitswelt (siehe Artikel auf S. 62). Manche Berliner Startups erlauben ihren Mitarbeitern gar nicht, mehr als drei Tage die Woche für sie zu arbeiten. Sie sollen nebenbei auch anderen Projekten nachgehen, um nicht zu sehr im eigenen Saft zu schmoren. In der digitalen Arbeitswelt gibt es nicht mehr die „eine“ Form der Anstellung und Unternehmensführung: Die Möglichkeiten sind vielfältig, Ausnahmen werden zur Regel und das „Normalarbeitsverhältnis“ und auch die „Normalbiografie“ sterben aus.
Kreativer Ideenaustausch in Netzwerken und Labs
Sucht man in Bezug auf die digitale Arbeitswelt nach einem Vorzeigeobjekt in der Offline-Welt, stößt man unweigerlich auf Coworking Spaces. Dort, wo Menschen im Online-Bereich arbeiten – ob als Journalist, Programmierer, Webdesigner, Texter oder anderes – bekommt Vernetzung eine zentrale Bedeutung. Und zwar nicht nur in genau dem eigenen Berufszweig, sondern darüber hinaus. Coworking Spaces sind nicht einfach nur ein Ort, wo sich Freiberufler tageweise einen Schreibtisch mieten können, um dem Home Office zu entfliehen. Coworking Spaces werden zu einem sozialen Netzwerk in der Offline-Welt. Es sind Kreativstätten, in denen Menschen der digitalen Arbeitswelt durch den Austausch Input von außen bekommen, sodass eigene Ideen fließen können. Oft genug entspinnen sich auch gemeinsame Projekte.
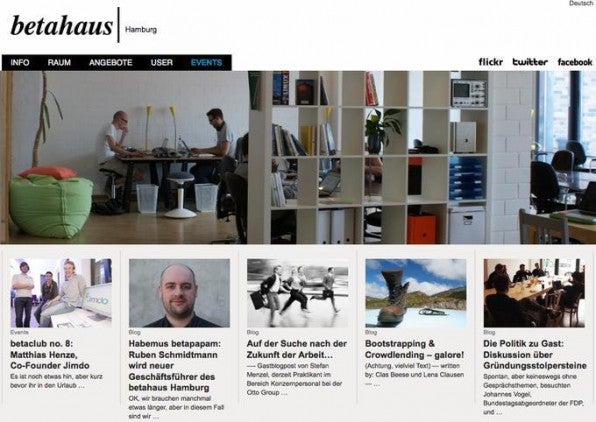
Das Konzept, ursprünglich gedacht für Freiberufler der digitalen Bohème, begeistert auch zunehmend Unternehmen (siehe Artikel auf S. 84). Dahinter steckt zum einen die Erkenntnis, dass das Braten im eigenen Saft nicht unbedingt zu neuen Kreativitätsschüben führt. Der andere Grund ist, dass immer mehr Digital Natives genau diese Arbeitsweise einfordern. „Wir bekommen ein Problem, wenn die Leute, die wir haben wollen, einer Festanstellung die Selbstständigkeit vorziehen“, erklärt Christoph Giesa, der sich bei der Otto-Group um die personalpolitischen Projekte kümmert, gegenüber der FAZ [2]. Deshalb schickt der Konzern immer öfter Angestellte ins Hamburger betahaus, wo sich die Mitarbeiter zwischen den selbständigen Kreativen tummeln. Auch TUI ließ seine Angestellten im Hamburger betahaus das Coworken ausprobieren und eröffnete anschließend in Hannover selbst einen Coworking Space. Das „Modul 57“ befindet sich nicht etwa auf dem TUI-Gelände, sondern in unmittelbarer Nähe zur Uni. Damit will der Konzern den Anschluss an die Kreativszene behalten, denn langfristig kann nur mithalten, wer innovativ bleibt. Und Innovation geschieht dort, wo das Übliche und Bekannte durch neue Denkanstöße und Input von außen bereichert wird.
Auch das Immobilienportal Immobilienscout [3] probierte im vergangenen Jahr aus, inwiefern sich Coworking zur Innovationsförderung nutzen lässt, und startete ein Projekt mit dem betahaus Berlin. Von der Zusammenarbeit erhoffte sich das Unternehmen neue Ideen,
zufriedenere Mitarbeiter und ein attraktiveres Arbeitsumfeld. „Wir
haben Immobilienscout dafür kurzerhand zur ‚Company in Beta‘ erklärt und
allen Mitarbeitern den Zugang zum betahaus geöffnet, um dort Meetings
abzuhalten, Offsites durchzuführen oder an unseren Community-Events
teilzunehmen. Gleichzeitig haben wir damit begonnen, gemeinsame Events zu veranstalten und Immobilienscout
darin zu unterstützen, den hauseigenen Inkubator ‚You is Now‘ aus der Taufe zu heben und zu füllen“, berichtet Christoph Fahle, der das betahaus mitgegründet hat [4]. Die Verknüpfung von Unternehmenswelt und offenem Coworking kann also durchaus für beide Seiten befruchtend sein. Gründer und Freelancer wiederum kommen so in Kontakt mit Unternehmen, bei denen sie Aufträge akquirieren oder für die sie möglicherweise sogar fest arbeiten können.
Interne Unternehmensstrukturen verändern sich
Auf lange Sicht verändern sich auch interne Unternehmensstrukturen. Ein Grund dafür ist, dass Menschen in der digitalen Arbeitswelt immer mehr zu Spezialisten werden. Die Arbeit wird grundsätzlich anspruchsvoller, da Routinetätigkeiten zunehmend vom Computer erledigt werden. Für die Menschen bleibt das übrig, was Maschinen (noch) nicht können: kreativ sein und Probleme auf unüblichen Wegen lösen, die über das „Schema F“ hinausgehen [1]. Dies verschiebt Hierarchien: Eigenschaften wie der flexible Umgang mit Neuem, Kreativität und das Filtern von wichtigen Informationen gewinnen an Bedeutung gegenüber Aspekten wie Fleiß (Überstunden!) und Vorzeige-Abschlüssen. Wissen hat nichts mehr mit der Anhäufung von Informationen zu tun, da diese immer und überall abrufbar sind, sondern mit der Fähigkeit, sich in bestimmten Bereichen zu spezialisieren und Informationen sinnvoll umzuwandeln und anzuwenden.
Wenn das spezielle und konkret anwendbare Wissen der Einzelnen zählt, sind starre Hierarchien und Bürokratie unangebracht und sogar hinderlich. Hier hinken Konzerne oft hinterher, da sie noch in alten Strukturen stecken und diese nicht so leicht ändern können – ein klarer Nachteil gegenüber jungen, agilen Unternehmen. „Wissen ist (…) nicht hierarchisch strukturiert, sondern situationsabhängig relevant oder irrelevant. Hier entsteht ein Dilemma: ‚Die da oben‘ entscheiden über Dinge, von denen sie meist weit weniger verstehen als ‚die da unten‘. Die Folgen sind bekannt: Demotivation, Reibungsverluste, Fehlentscheidungen und Frust“, fasst Ulrich Klotz das Phänomen zusammen. Hierarchische Strukturen ergeben laut Klotz nur in einer Produktionsgesellschaft Sinn, nicht aber in einer Wissensgesellschaft [1].
Am eindrücklichsten zeigt sich der Umschwung in der Open-Source-Bewegung. Stärker als in anderen Bereichen finden sich hier die Netzstrukturen wieder: flache Hierarchien, wenig Bürokratie, kurze Entscheidungswege, schnelles Vorankommen. Weil alles auf Freiwilligkeit und Offenheit beruht, muss keiner aus Selbsterhaltungsgründen Wissen zurückhalten, um die eigene Stellung nicht zu gefährden. Nicht Hierarchieebenen zählen, sondern inhaltliche Relevanz und das Weiterbringen der Sache. Nur so ist es zu erklären, dass Menschen freiwillig und unentgeltlich an der Fortentwicklung von Linux, Wikipedia, Firefox oder anderen Projekten basteln.
Mehr Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter
Flachere Hierarchien bedeutet auf der einen Seite Arbeiten auf Augenhöhe und gegenseitige Wertschätzung, auf der anderen Seite aber auch eine höhere Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter. In den alten Strukturen waren Aufgaben und Bereiche oft klar und unmissverständlich formuliert. Dies funktioniert in der digitalen Arbeitswelt so meist nicht mehr. Kreatives Mitdenken betrifft alle. „Leute, die von früheren Anstellungen her klare Ansagen gewohnt sind und immer Angst haben, etwas falsch zu machen, fühlen sich meist nicht wohl bei uns“, sagt Christian Springub, Mitgründer des Website-Baukastensystems Jimdo (Artikel S. 116). Die neuen Arbeitsstrukturen, die sich in der digitalen Arbeitswelt ergeben, können für Mitarbeiter auch anstrengend sein, wenn sie gewohnt waren, dass andere für sie denken.
Dementsprechend geht es in den jungen, agilen Unternehmen bei Einstellungsfragen immer stärker um den „cultural fit“ und die Frage, ob ein Mitarbeiter mit seiner Art und der Art des Arbeitens zur Unternehmenskultur passt. Die Wichtigkeit bestimmter Fähigkeiten verschiebt sich: Vielseitigkeit, Flexibilität, Teamwork, Selbstverantwortung und die Begeisterung für das eigene Tun sind wichtiger denn je geworden. „Mehr kreative Individuen“ statt „brave, angepasste Ausführer“ sind gefragt: „Fleiß und Ausdauer allein reichen nicht mehr, denn irgendwo wird irgendwer immer noch fleißiger sein“, so Ulrich Klotz. Inhaltliche Kompetenzen lassen sich immer noch erlernen, wenn der Wille da ist. Kreative Denkstrukturen, soziale Kompetenzen und der „cultural fit“ meist nicht.

Herausforderung Interne Kommunikation
Die neuen Arbeitsmöglichkeiten fordern von beiden Seiten ein hohes Maß an Flexibilität und Offenheit. Unternehmen, die in agilen Strukturen arbeiten wollen und etwa wie die Macher der Blog-Software WordPress an weltweit verstreuten Standorten arbeiten, stehen vor der Herausforderung, trotz der Distanzen gut zu kommunizieren und den Verlust von Ressourcen einzudämmen. Es ist nicht leicht, über große örtliche und zeitliche Distanzen hinweg an einem Strang zu ziehen, voneinander zu wissen und über aktuelle Dinge auf dem Laufenden zu bleiben (siehe Artikel auf S. 41).
Deshalb gehen manche junge Unternehmen auch bewusst einen anderen Weg und halten an Strukturen fest, die konservativ und altmodisch anmuten. Das bereits erwähnte, softwaregetriebene Startup Jimdo hat sich dafür entschieden, keine Freelancer zu beschäftigen, sondern nur Menschen, die in Vollzeit und vor Ort für das Unternehmen arbeiten. Die Hamburger legen einen Fokus auf Kommunikation und richten danach ihre Strukturen aus. Weil ihr Modell stringent ist, haben sie dennoch keine Schwierigkeiten, an gute Mitarbeiter zu kommen (siehe auch Artikel auf S. 66). Das zeigt: Im digitalen Zeitalter sind unterschiedlichste Arbeitsmodelle denkbar, wenn sie konsequent durchgezogen werden und sich an einer bestimmten Kernüberzeugung orientieren.
Social Media und Recruitment: Online-Reputation wird wichtiger
Die sozialen Medien wurden lange Zeit vor allem privat genutzt oder
als Marketingkanal von Firmen. Mittlerweile sind sie für Arbeitgeber
aber auch zu einem Recruitment-Kanal geworden, der von vielen Menschen
noch unterschätzt wird. Arbeitgeber schauen sich heute vor
Einstellungsgesprächen den Abdruck an, den ein potenzieller Bewerber im
Netz hinterlassen hat, weshalb der Umgang mit Internet und Social Media eigentlich als Unterrichtsfach in die Schulen gehört. Unsere Netz-Aktivitäten sind zu persönlichen Visitenkarten geworden, die nicht einfach zu löschen sind. Headhunter beschäftigen
mittlerweile ganze Abteilungen, um die Online-Reputation von Menschen zu
checken. Spezialisierte Agenturen oder Anwendungen wie Reputationtool [5] helfen dabei, die eigenen Netzspuren
aufzudecken, auszuwerten und damit aktiv zu beeinflussen [6].
Doch
es geht nicht nur darum, negative Spuren zu vermeiden. Die sozialen
Netzwerke dienen heute genauso dazu, sich auf dem Arbeitsmarkt
positiv zu präsentieren. Wer bewusst und gezielt seine Netz-Identität
steuert, kann bei Unternehmen punkten und aus der Masse hervorstechen.
Tools wie PeerIndex [7] und Klout [8] werden zunehmend von Unternehmen genutzt, um interessante Bewerber auf ihre Netzaktivität hin abzuklopfen, vor allem in der Marketingbranche.
Klout filzt die eigenen Social-Media-Aktivitäten und
ermittelt, wie groß der Einfluss auf die Netzgemeinde ist, ob man
zu den so genannten Influencern gehört oder eher zu den Mitläufern (siehe Artikel auf S. 48). „Meine Leistungen während der vergangenen 15
Jahre waren nicht so wichtig wie dieser Score“, musste der
Brand-Manager Sam Fiorella erkennen, als der interessante Job einem
Mitbewerber gegeben wurde, der einen höheren Klout-Score
aufwies [9]. Inhaltlich ist diese Form des Recruitments zwar nur bedingt sinnvoll, da sie mehr über die Quantität als über die Qualität von Netzaktivitäten aussagt; trotzdem wird sie in bestimmten Bereichen zunehmend genutzt.

Viel zu wissen, ist keine Kompetenz mehr
Wer Teil der digitalen Arbeitswelt ist, bekommt heute schnell das
Gefühl, von allem Ahnung haben zu müssen: Social Media als
Marketing-Instrument, Suchmaschinen-Optimierung, Google Adwords und
Adsense, die neuesten Geräte und Anwendungen, nicht zu vergessen etwas
Webdesign- und Programmierkenntnisse und dann noch die Sache mit den
Netzwerken („Google+? Ich habe mich eben erst an Facebook gewöhnt,
nachdem ich gerade MySpace verstanden hatte!“).
Heute, wo so viele Informationen abrufbar sind, wird eine Fähigkeit
wichtiger denn je: Auswählen. In welche Bereiche lohnt es sich zu
investieren, was sollen Experten erledigen, was kann die Crowd
übernehmen? Viel zu wissen ist keine Kompetenz mehr, entscheidend ist,
die richtigen Filter zu haben und auf passende Aggregatoren
zu setzen, die Informationen vorsortieren. Wer dann aber das
Bedürfnis hat, bestimmte Dinge doch selbst zu lernen, hat wiederum
Glück: Im Netz ist praktisch alles lernbar. Programmierkenntnisse
erwirbt man sich bei Codecademy, Englisch-Liveunterricht gibt es bei
Englishtown und für den Rest sorgen Online-Akademien wie die Khan
Academy (siehe Artikel auf S. 70).

Fokussierung auf das Wesentliche: Digitaler Minimalimus
So schön das Leben im Netz auch ist – die Gefahr des Versackens ist groß. Dies sehen auch manche Unternehmen so und sperren deshalb bestimmte Websites für ihre Mitarbeiter. Fraglich, ob dies die beste Lösung ist. Aber dass die unzähligen Geräte, Anwendungen und Onlinedienste zu einer potenziellen Ablenkung im Arbeitsalltag geworden sind, wird kaum jemand bestreiten. Vielen fällt es heute schwer, sich längere Zeit auf eine bestimmte Tätigkeit zu konzentrieren, da von allen Seiten Input einströmt – sowohl im Beruf als auch in der Freizeit. Die Fokussierung auf das Wesentliche hat ihre Ausprägung in der Lebensweise des „Minimalismus“ gefunden. Dahinter steht die Fragestellung: Was braucht man wirklich, was lenkt nur ab?
Das Prinzip hat in Form des „digitalen Minimalismus“ auch in der digitalen Arbeitswelt Einzug gefunden. Lieber alles mobil und in unsichtbaren Wolken verstaut dabei haben, statt unzählige Arbeitsgeräte samt Zubehör zu besitzen, lautet die Devise (siehe Artikel auf S. 120). Allerdings führt das Netz zu einer neuen Art des Besitzens, das zwar keinen Platz verbraucht, aber oftmals unsere persönlichen (Gehirn-)Speicherkapazitäten in Anspruch nimmt: Fünf verschiedene Soziale Netzwerke, sämtliche Online-Tools, das Smartphone vollgestopft mit Anwendungen, die uns mit kleinen roten Zahlen auf dem Display an ihre Existenz erinnern: Manchmal würde es unserem Arbeiten gut tun, auch hier einmal kräftig auszumisten.
Mit der Atemlosigkeit des Netz-Lebens umgehen
Das Ausmisten fällt vielen auch deshalb schwer, weil sich in der digitalen Arbeitswelt das Rad ständig weiterdreht: Jeder Tag könnte mit einer Liste der Dinge beginnen, die man recherchieren, verstehen und ausprobieren möchte. Von den neuesten Trends bis hin zu veränderten Datenschutzbedingungen der viel genutzten Netzwerke. Das Leben im Web ist atemlos, hinter jedem eingegebenen Suchbegriff wartet so viel Neues.
Auch hier liegen Freud und Leid nah beieinander: Viele genießen es, dass sie heute so mit ihrer Arbeit verschmelzen, dass sie nicht mehr zwischen der (notwendigen) Arbeit und dem (wohlverdienten) Wochenende unterscheiden müssen. Aber wo die Arbeit das Leben ist, verschwimmen oftmals jegliche Grenzen. Nicht jeder kann mit einer ständigen Erreichbarkeit umgehen. Hier ist eine Eigenverantwortlichkeit nötig, die oft nur über Schmerzen gelernt wird. Und viel Disziplin bei der Umsetzung individueller Grenzen: Keine E-Mails ab 18.00 Uhr mehr checken, im Urlaub höchstens einmal ins Internet-Cafe, klare Wochenend-Rituale und fest eingeplante Termine für Sport und Entspannung sind Möglichkeiten, mit der Atemlosigkeit des digitalen Menschen und der ständigen Erreichbarkeit umzugehen (siehe Artikel auf S.123).
Fazit
Die digitale Arbeitswelt ist spannend – nicht besser oder schlechter als früher, aber anders. Mit vielen Chancen und zahlreichen Herausforderungen. Wer nicht als Digital Native aufgewachsen ist, tut sich manchmal schwer mit den vielfältigen Anforderungen und der wahnsinnigen Geschwindigkeit, die das Netzzeitalter zu fordern scheint.
Auch wenn sich bestimmte Arbeitsweisen wie zum Beispiel das orts- und zeitunabhängige Arbeiten immer stärker herausbilden, gibt es doch nicht das „eine“ passende Modell. Wem geregelte Arbeitstage besser liegen als die totale Selbstbestimmung, kann diesen Arbeitsstil auch bei einem jungen, agilen Startup finden und nicht nur im Großunternehmen. Umgekehrt ist der Wunsch nach Flexibilität und lockeren Strukturen kein Ausschlusskriterium mehr, um im Konzern zu arbeiten, da auch große Firmen sich zunehmend auf die neuen Arbeitsmodelle einlassen und sie bewusst miteinbeziehen.
Sorgen muss sich der moderne (Arbeits-)Mensch insbesondere um eines: sich selbst. Die aktuelle Burnout-Rate bedeutet nicht, dass Menschen mit ihrer Arbeit heute unglücklicher sind als früher. Aber sie zeigt auf, dass es Menschen schwerfällt, in der digitalen Arbeitswelt noch Grenzen zu ziehen zwischen Arbeit und Freizeit, Aktivsein und Abschalten, Anforderung und Entspannung. Vielleicht ist dies zur größten Herausforderung überhaupt geworden im digitalen Zeitalter: das Erspüren der eigenen Grenzen, denn sie sind nicht mehr von außen vorgegeben. Wer dies schafft, wird die positiven Seiten der Arbyte um so mehr zu schätzen wissen.


Bitte beachte unsere Community-Richtlinien
Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.
Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.
Dein t3n-Team