E-Commerce-Recht: Abmahnfallen für Onlinehändler

(Grafik: Shutterstock / sdecoret)
Eine kleine Unachtsamkeit reicht und schon flattert eine Abmahnung ins Haus. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch ganz schön ins Geld gehen. Laut einer Studie des Händlerbund haben 2017 insgesamt 28 Prozent der befragten Online-Händler eine Abmahnung erhalten (2016: 24 Prozent). In 43 Prozent der Fälle lag die Höhe der durchschnittlich durch Abmahnungen entstandenen Kosten bei maximal 500 Euro. 16 Prozent mussten zwischen 1.000 und 2.000 Euro zahlen, sechs Prozent sogar über 3.000 Euro. Die beste Strategie gegen solche Ärgernisse ist es, überhaupt keinen Anlass für Abmahnungen zu liefern. Was sind die häufigsten Abmahngründe und wie können Onlinehändler sich davor schützen? Einige von ihnen beziehen sich auf schon länger bestehende Gesetze oder Verordnungen. Andere wiederum sind erst Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres in Kraft getreten. Ein Überblick.
Geoblocking-Verordnung
Eine wichtige Gesetzesänderung trat mit der Geoblocking-Verordnung (EU) Nr. 2018/302 noch im Dezember 2018 in Kraft. Danach ist es grundsätzlich verboten, den Zugang zu Websites, Apps oder Plattformen aufgrund einer geografischen Zuordnung zu beschränken. Ausnahmen davon sind nur nach ausdrücklicher Zustimmung zulässig oder um rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Außerdem ist es verboten, den Zugang zu Waren oder Dienstleistungen für Kunden zu beschränken, wenn dies auf der Staatsangehörigkeit, dem Wohnsitz oder dem Ort der Niederlassung basiert. Oder anders gesagt: Alle Kunden sollen Waren genau zu den gleichen Bedingungen erwerben können, wie das ein vergleichbarer Kunde mit Wohnsitz in einem anderen Staat kann. Ein deutscher Kunde muss also einen französischen Shop genauso aufrufen und dort einkaufen können wie ein französischer Kunde, um etwa vom lokalen Verkauf oder von lokalen Produkten zu profitieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass Onlinehändler europaweit liefern müssen. Bietet der Händler seinen inländischen Kunden eine Abholung an, muss dies auch für Kunden aus anderen Mitgliedsstaaten möglich sein. Gleiches gilt für die Lieferung an eine Adresse in einem Mitgliedsstaat, in das der Anbieter liefert. Das bedeutet, dass Onlinehändler in ihrem Bestellprozess die Angabe einer unionsweiten Rechnungsadresse ermöglichen müssen. Sie können jedoch die Lieferanschrift beschränken.
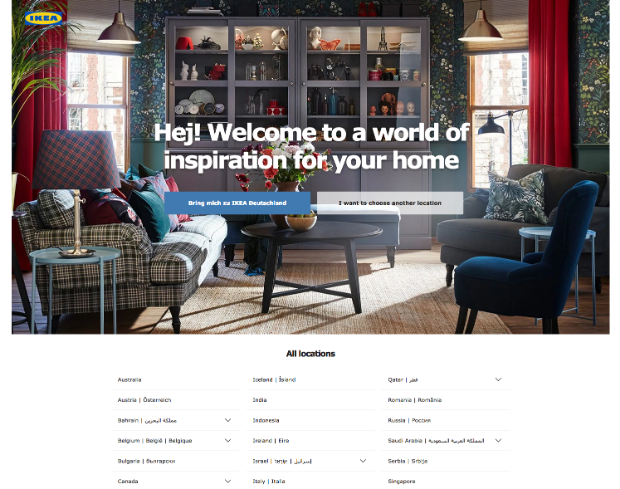
Große Marken wie Ikea bieten unterschiedliche regionale Verkaufsportale an. Die Geoblocking-Verordnung stellt sicher, dass Kunden auch von Rabatten und Aktionen in anderen Regionen profitieren können. (Screenshot: Ikea)
Darüber hinaus verbietet die Geoblocking-Verordnung diskriminierende Zahlungsbedingungen (Art. 5). Anbietern ist es untersagt, unterschiedliche Zahlungsbedingungen anzuwenden, wenn dies aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes, des Ortes der Niederlassung des Kunden, des Standortes des Zahlungskontos, des Ortes der Niederlassung des Zahlungsdienstleisters oder des Ausstellungsortes des Zahlungsinstruments innerhalb der EU geschieht. Das Verbot gilt allerdings nur für Zahlungen, die über eine elektronische Transaktion durch Überweisung, Lastschrift oder eine Zahlungskarte innerhalb derselben Zahlungsmarke und Zahlungskategorie erfolgen, die Zahlungsdienstanbieter eine sogenannte starke Kundenauthentifizierung sicherstellen und die Zahlung auch in einer Währung erfolgt, die der Anbieter akzeptiert. Damit bleibt es nach wie vor den Händlern überlassen, welche Zahlungsmittel und welche Marke sie akzeptieren. Bietet ein Shop-Betreiber aber zum Beispiel die Lastschrift in Deutschland an, so muss er dieses Zahlungsmittel grundsätzlich auch für alle anderen EU-Staaten zulassen. Anderenfalls drohen Abmahnungen und Bußgelder.
Verpackungsgesetz
Am 1.1.2019 trat das neue Verpackungsgesetz (VerpackG) an die Stelle der alten Verpackungsverordnung. Es findet nun auf alle Verpackungen Anwendung und gilt gegenüber privaten Endverbrauchern. Dieser Begriff ist jedoch so weit gefasst, dass neben Verbrauchern auch Unternehmer darunter fallen. Außerdem nutzt das VerpackG den Begriff des Herstellers. Das ist grundsätzlich derjenige, der Verpackungen erstmalig in den Verkehr bringt. Auch der Onlinehändler befüllt die Versandverpackung erstmalig mit Ware und diese Verpackung fällt typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall an. Damit wird er zum Hersteller im Sinne des VerpackG. Für Onlinehändler gilt nach wie vor eine Beteiligungspflicht am dualen System, die jedoch grundsätzlich bereits nach der vorherigen Rechtslage galt. Neu hingegen ist die Pflicht, sich bei der neu gegründeten Zentralen Stelle zu registrieren. Mit der erfolgreichen Registrierung erhalten Sie als Hersteller eine Registriernummer, mit der Sie Ihre Beteiligung an einem dualen System abschließen können. Zudem müssen Onlinehändler von Einweg- oder Mehrwegverpackungen, die mit Getränken befüllt sind und der Pfandpflicht unterliegen, mit Informationstafeln oder -schildern mit den Worten „Einweg“ oder „Mehrweg“ darauf hinweisen, ob sie solche Verpackungen nach der Rückgabe wiederverwenden. Diese Tafeln müssen für die Endverbraucher in der Verkaufsstelle deutlich sicht- und lesbar sein und sich in unmittelbarer Nähe zu den entsprechenden Verpackungen befinden. Diese Pflicht gilt auch beim E-Commerce. Verstöße gegen Systembeteiligung-, Registrierungs- oder Kennzeichnungspflichten können ebenfalls eine Abmahnung zur Folge haben.
Datenschutzgrundverordnung
Eines der im letzten Jahr am meisten diskutierten und für Händler beunruhigendsten Themen war die Frage, ob Mitbewerber Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abmahnen könnten. Im Vorfeld und auch noch nach Inkrafttreten der Verordnung hatten viele geradezu eine Welle von Abmahnungen befürchtet. Diese ist vorerst ausgeblieben – möglicherweise, weil potenzielle Abmahner selbst unsicher waren. Doch auch 2019 ist diese Frage immer noch nicht einheitlich geklärt. Allerdings sind bereits einige Gerichtsurteile ergangen, die sich mit dieser Angelegenheit beschäftigt haben. Zwei Gerichte haben die Abmahnbarkeit von DSGVO-Verstößen verneint, eines hat dies bejaht und ein weiteres kam zu dem Schluss, „es kommt darauf an“. Bei Letzterem handelt es sich um das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Hamburg (Urt. v. 25.10.2018, 3 U 66/17). Es ist aufgrund der höheren Instanz vorläufig gewichtiger als die drei anderen, die von Landgerichten entschieden wurden. Das OLG entschied, dass das Ergebnis von einer Einzelfallprüfung abhängt. Demnach ist für jeden Fall gesondert festzustellen, ob es sich bei der verletzten Norm um eine Marktverhaltensregelung im Sinne des § 3a des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) handelt. Dann sei der Anwendungsbereich des UWG eröffnet und einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung – auch durch Mitbewerber – stünde nichts mehr im Wege.
Die häufigsten Abmahngründe
Neben diesen neuen Abmahnfallen gibt es auch einige Klassiker. Abmahner konzentrieren sich gerne auf die folgenden Punkte:
Widerrufsrecht
Die meisten Abmahnungen betreffen immer noch das Widerrufsrecht. Verbrauchern steht grundsätzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu, über das sie der Unternehmer informieren muss. Die Widerrufsbelehrung ist klar und verständlich vor Abgabe der Bestellung zur Verfügung zu stellen. Das gleiche gilt für das Muster-Widerrufsformular. Es ist ebenfalls Teil der Widerrufsbelehrung und lässt sich darunter als Text darstellen. Dieses Formular ist zwar für die Praxis völlig ungeeignet, da Daten abgefragt werden, die der Verbraucher häufig nicht mehr zur Hand hat (etwa das Bestell- und Lieferdatum). Die für den Unternehmer wesentlichen Informationen wie Kunden- oder Bestellnummer fehlen hingegen gänzlich. Deshalb wird es in der unternehmerischen Praxis oft nicht angenommen und bereitgestellt. Da dieses Formular jedoch ein Pflichtbestandteil jeder Belehrung ist, sind Abmahnungen an der Tagesordnung.
Neben Fehlern in der Widerrufsbelehrung ist ein weiterer Mangel, dass viele Unternehmer noch immer veraltete Formulierungen benutzen, obwohl das neue Widerrufsrecht bereits seit 2014 gilt. Diese sind für Abmahner sehr leicht zu finden. Sie müssen beispielsweise nur nach „EGBGB“ suchen, denn diesen Passus gibt es seit 2014 nicht mehr. Mit den Folgen einer falschen Widerrufsbelehrung befasste sich auch das Amtsgericht (AG) Dülmen (Urteil vom 13.3.2018 – 3 C 282/17). Ein Verbraucher hatte ein Elektromobil bestellt, und der Händler stellte ihm eine veraltete Widerrufsbelehrung zur Verfügung. Der Verbraucher fuhr 35 Kilometer, wobei er das Elektromobil beschädigte und verdreckte. Nach drei Wochen widerrief er den Vertrag, bekam den vollen Kaufpreis erstattet und musste keinen Wertersatz zahlen – und das alles, weil der Händler ihn nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt hatte. Der Fall zeigt, dass Shop-Betreibern in solchen Fällen also nicht nur durch Abmahnungen Kosten und Nachteile drohen.
Schlichtungsplattform
Seit dem 9. Januar 2016 sind Unternehmer verpflichtet, einen Link auf die Schlichtungsplattform der EU-Kommission (OS-Plattform) leicht verfügbar auf ihre Website zu stellen – zum Beispiel ins Impressum. Das soll Verbraucher darauf hinweisen, dass sie diese bei Problemen mit dem Onlinehändler nutzen können. Erfüllt ein Shop-Betreiber diese Informationspflicht nicht, ist das ebenfalls ein Verstoß, der regelmäßig Abmahnungen nach sich zieht. Dabei haben bereits mehrere Gerichte entschieden, dass es nicht reicht, die Internetadresse der OS-Plattform als reinen Text zur Verfügung zu stellen. Vielmehr muss die URL verlinkt sein. Das ist bei vielen Onlinehändlern nicht der Fall und wird ebenfalls oft abgemahnt. Diese Pflicht gilt übrigens auch für Angebote auf Onlinemarktplätzen. Häufig ist es hier aufgrund begrenzter Felder schwierig, eine HTML-Verlinkung einzubauen, etwa bei einer GmbH & Co. KG im Ebay-Impressumsfeld.
Versicherter Versand
Beim Handel mit Verbrauchern tragen Händler stets das Versandrisiko. Dabei geht die sogenannte Transportgefahr erst mit der Ablieferung der Waren beim Kunden auf diesen über und nicht bereits durch die Übergabe an ein Transportunternehmen. Daher dient es vor allem den Interessen des Onlinehändlers, wenn er eine Versandversicherung von Waren in seinen Versandbestimmungen hervorhebt oder dafür wirbt. Dem Verbraucher vermittelt dies jedoch den irreführenden Eindruck, dass es sich dabei um einen besonderen Vorteil für ihn handelt und er anderenfalls die Transportgefahr selbst tragen müsste. Das sollte jeder Shop-Betreiber vermeiden. Gleiches gilt für einen versicherten Versand als Option, wenn der teurer als der unversicherte Versand ist. Beides gilt als irreführende Werbung und ist damit abmahnfähig.
Garantiewerbung
Sehr viele Abmahnungen betreffen auch die Garantiewerbung ohne Angabe der dafür einschlägigen, konkreten Garantiebedingungen. Onlinehändler müssen den Verbraucher gegebenenfalls darüber informieren, dass es einen Kundendienst, Kundendienstleistungen und Garantien gibt und was die Bedingungen dafür sind. Das „gegebenenfalls“ bedeutet nur, dass die Informationspflicht entfällt, falls es keine Garantien gibt. Ansonsten müssen sich die Angaben über die wesentlichen Bedingungen der Inanspruchnahme (Inhalt der Garantie: vor allem Laufzeit und räumlicher Geltungsbereich sowie Garantiegeber mit Namen und Anschrift) bereits im Zusammenhang mit der Garantiewerbung im Shop abrufen lassen. Das kann zum Beispiel über eine entsprechende Verlinkung wie „Garantiebedingungen“ geschehen.
Zudem ist ein Hinweis erforderlich, dass die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers bestehen und nicht durch die Garantie eingeschränkt werden. Diese Informationen können Onlinehändler auch in der Produktbeschreibung oder in den verlinkten Bedingungen zur Verfügung stellen, jedoch nicht allein irgendwo in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Informiert ein Shop also zum Beispiel mit der Angabe „Fünf Jahre Garantie“ darüber, dass es diese Garantie gibt, bietet aber keine weitere Angabe zu den Bedingungen dieser Garantie, so verstößt der Händler gegen seine (vorvertragliche) Informationspflicht und damit gegen eine Marktverhaltensregelung.
Fehlende Grundpreisangaben
Ebenfalls wiederholt Gegenstand von Abmahnungen sind fehlerhafte oder sogar gänzlich fehlende Grundpreisangaben. Wenn ein Onlinehändler zum Beispiel Produkte in Fertigpackungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheiten ohne Umhüllung nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche anbietet, muss er die Grundpreise mit angeben. Diese Pflicht ist also nicht auf ein bestimmtes Produktsortiment beschränkt. Es erfasst die verschiedensten Produkte wie eine Flasche Saft, eine Tube Sonnencreme, Bodenbeläge, Klebeband oder eine Packung Knete. Dabei ist der Grundpreis der Preis pro Mengeneinheit. Also zum Beispiel der Preis für ein Kilogramm oder einen Liter des Produktes. Bei Produkten mit weniger als 250 Gramm oder Milliliter dürfen Shops auch einen Grundpreis pro 100 Gramm oder Milliliter verwenden. Dieser Grundpreis muss bereits dann zu sehen sein, wenn ein Onlinehändler für das Produkt unter der Angabe von Preisen wirbt – also etwa auch auf den Übersichtsseiten eines Shops oder in der Galerieansicht von Ebay, wenn dort Preise zu sehen sind. Letzteres funktioniert technisch leider nur, indem Händler den Grundpreis am Anfang der Ebay-Artikelbeschreibung nennen. Gratiszugaben müssen sie dann in den Grundpreis einrechnen, wenn es sich um dasselbe Produkt handelt. Gibt es zum Beispiel zu einem Kasten Erfrischungsgetränke zwei Flaschen gratis dazu, muss ein Händler diese Gesamtmenge seinem Grundpreis zugrunde legen. Bei Bündelungen – etwa verschiedener Teesorten – sind jedoch keine Grundpreisangaben erforderlich.
Fazit
Viele Abmahnungen können Onlinehändler bereits vermeiden, indem sie aktuelle Rechtstexte verwenden. Dabei dürfen Händler jedoch keinesfalls die Texte aus ihrem Onlineshop auch auf Verkaufsplattformen wie Ebay und Amazon verwenden. Hier gibt es bedeutende Unterschiede. Neben den bekannten Abmahnklassikern sind mit der Geoblocking-Verordnung und dem neuen Verpackungsgesetz zwei Gesetze mit neuem Abmahnpotenzial in Kraft getreten. Die befürchtete DSGVO-Abmahnwelle ist entgegen vieler Prognosen ausgeblieben. Aber auch hier gibt es erste Abmahnfälle, weshalb die Verordnung auch 2019 viele Händler beschäftigen wird.


Vielen Dank für diesen Ratgeber. Hat mir tatsächlich sehr geholfen und mich auf einen Fehler in meinem Shop aufmerksam gemacht.