Age of Context: Wie kontextsensitive Apps unseren Alltag automatisieren

Kontextsensitive Apps. (Foto: linzyslusher/iStock)
Noch drei Stunden 15 bis nach Hause, sagt Google Now. Und Google Now weiß, dass auf der A2 Hannover – Dortmund gerade Stau ist. Und es weiß, dass ein Umweg nichts bringt.
Google Now, die Erweiterung für Googles Suche, ist eine von vielen kontextsensitiven Apps, die Informationen dann anzeigen, wenn sie gebraucht werden – der Routenplaner den Weg für den nächsten Termin, Filmtipps, wenn ein Kino in der Nähe ist, dazu Fußballergebnisse, Sehenswürdigkeiten, Wetter. Je nach Ort, Zeit und Interessen bekomme ich passende Informationshäppchen. Mit Applikationen wie Google Now ist das Thema „Kontext“ auf Smartphones und Tablets angekommen. Vorbei die Zeiten, in denen Informationen auf Knopfdruck ausgespuckt wurden. Heute sollen uns komplizierte Algorithmen alles zum passenden Zeitpunkt proaktiv präsentieren.
Eng verknüpft ist das Thema mit einem weiteren Trend: Quantified Self. Dutzende Apps und Gadgets sollen uns helfen, uns zu beobachten und zu analysieren – mit dem Ziel, uns mehr zu bewegen und gesünder zu essen. Fitness-Tracker messen Schritte und berechnen den Kalorienverbrauch, sie messen den Schlaf und sollen uns zum perfekten Zeitpunkt wecken. Für 2017 wird der Gesamtmarkt auf etwa 300 Millionen solcher „Wearable Devices“ geschätzt.
Internet der Dinge: Sprechende Bäume, vernetzte Städte
John Chambers, Geschäftsführer bei Cisco, sieht uns schon heute in der vierten Phase des Internets: Auf Phase eins – E-Mail, Browser und Suche – folgten mit E-Commerce Phase zwei und mit Social Media, Mobile Web und Cloud Phase drei. Und nun stehen wir am Beginn von Phase vier – dem Internet der Dinge. Damit verändert sich auch außerhalb des Privatlebens einiges – vergleichbar mit der Industrialisierung werden erneut Arbeitsprozesse umgewälzt. In den USA testen Unternehmen mit Sensoren bestückte Felder, die – automatisch bewässert und gedüngt – dem Bauern melden, wenn Erntezeit ist. In München arbeitet das Startup tado an einer Heizung, die sogar die Wettervorhersage berücksichtigt und so noch effizienter sein soll als Systeme, die „nur“ berechnen, wann es billigen Strom gibt. Bald schon könnten Bäume selbstständig Klimaveränderungen melden, Tiere automatisiert Daten an die Besitzer verschicken. „Die ganze Welt wird IP“, sagt John Chambers. In seiner Vision lässt sich alles vernetzen – sogar ganze Städte.
Doch auch im Büro ist Kontext angekommen. „Software kann heute Informationen semantisch verarbeiten. Sie versteht somit den Kontext einer Information“, sagt Marketingprofessorin Heike Simmet. Das könne beispielsweise zu einem individuelleren Kundenservice und „zu Kundenbegeisterung im Sinne des Customer Experience Managements (CEM) an allen Touchpoints des Kundenkontaktes führen“. Kundenbedürfnisse lassen sich sogar schon im Vorfeld erfassen, glaubt sie – und nennt als Beispiel ein Airline-Callcenter: „So ergibt die Information verspäteter Flug in Verbindung mit der Ticketbuchung und dem aktuellen Benutzerprofil die Chance, dem Kunden automatisch passende Informationen über alternative Verbindungen und Anschlüsse mit anderen Verkehrsmitteln auf das Smartphone zu übermitteln und auf diesem Wege zu einer individuellen Problemlösung für den Kunden beizutragen.“
Nachholbedarf im Mittelstand
Simmet sieht hier nicht nur Entwickler in der Pflicht, sondern auch Unternehmen, sie konstatiert einen „Nachholbedarf im Mittelstand“. Und: Noch fehlten der jetzigen Generation von Managern und IT-Verantwortlichen Vorstellungskraft und Mut, sich eine solche App-Welt vorzustellen.
In anderen Bereichen ist dieser Mut schon lange da, auf dem Finanzmarkt etwa. Vollautomatisch analysieren Software-Programme Börsenkurse und nehmen in Millisekunden An- und Verkäufe vor. Schon heute soll dieses „Algo-Trading“ an manchen Börsen einen Umsatz-Anteil von bis zu 50 Prozent haben, an der Terminbörse Eurex hat sich der automatisierte Handel von 2004 bis 2006 vervierfacht – mit teils verheerenden Folgen wie abrupten Kursschwankungen oder Markteinbrüchen. So wird Algo-Trading dafür verantwortlich gemacht, dass der Dow Jones am 6. Mai 2010 in nur acht Minuten um über 1.000 Punkte fiel, und auch der Börsenkrach am 19. Oktober 1987 – der „Schwarze Montag“ – soll Folge des automatisierten Handels gewesen sein.
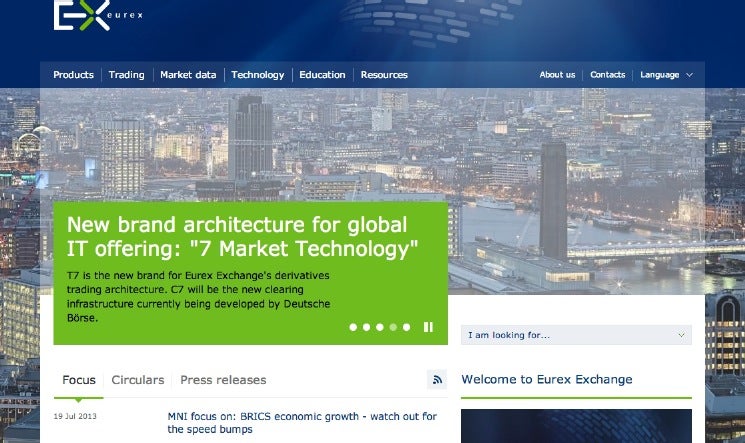
An der Termin-Börse Eurex führte das Algorithmic Trading unter anderem zu massiven Kursschwankungen und Markteinbrüchen.
Consumer-Technology: Durchbruch?
Dagegen wirken Activity-Tracker noch wie Spielzeug – doch die Vision ist klar: Denkt man hier weiter in Richtung kontextualisierter Apps, tut sich eine Welt auf, die bis vor wenigen Jahren noch Science-Fiction gewesen wäre.
Stellen wir uns die folgende Kombination vor: Ein Armband, das über Sensoren und GPS unsere Bewegung misst und unseren Schlaf überwacht, gekoppelt mit dem Smartphone. Dazu täglich eine mit einem winzigen Mikrochip ausgestattete elektronische Pille (beispielsweise vom britischen Unternehmen Proteus), die ihre Energie aus der Magensäure bezieht, deren Sende-Antenne aus ungiftigen Silber-Nanopartikeln besteht und die einfach wieder ausgeschieden werden kann. Sie misst Körpertemperatur, Puls, Atemfrequenz, Hormonhaushalt sowie eingenommene Medikamente und übermittelt die Daten an eine Art elektronisches Tattoo auf der Haut. Auf dem Smartphone: eine App, die nicht nur die Informationen dieses Tattoos ausliest, sondern die per Kamera auch unser Essen erkennt und berechnet, wie viele Kalorien es hat (die App „Meal Snap“ will das schon heute können), die mit einer smarten Waage synchronisiert wird, die Gewicht, Körperfett und Raumluftqualität misst (Withings bietet solche Waagen schon an) und die –gekoppelt mit unserem Kalender – weiß, welche Termine wir haben, wie unser Trainigsplan aussieht oder für wann wir den nächsten Urlaub gebucht haben und wo es hingeht. Dass sich ein solches System auch mit Gadgets wie der Google Glass verbinden ließen, wirkt da schon beinah banal.
Diese App könnte uns den besten Zeitpunkt für all unsere Aktivitäten berechnen. Sie würde uns mit Hilfe von Körperwerten, Geschäftsterminen und unserem Aufenthaltsort sagen, wann und was wir essen sollen, wann es Zeit für ein Power-Napping ist oder wo im Tagesablauf Sport und Freizeit am besten hinein passen. Sie würde uns zum Beispiel sagen, dass wir in drei Stunden einen wichtigen Termin haben und dass es gut für die Konzentration wäre, noch eine Stunde ins Fitnessstudio zu gehen und dann einen Salat zu essen. Sie würde uns warnen, wenn unser Blutzuckerspiegel zu stark sinkt oder wir zu wenig schlafen. Und: Sie könnte all diese Daten übersichtlich aufbereitet an unseren Hausarzt schicken, der immer wüsste, wie es uns geht. Für die Prävention und Früherkennung von Krankheiten ein unglaublicher Fortschritt – mit Blick auf die Frage allerdings, wie etwa Krankenkassen mit solchen Echtzeitdaten umgehen würden, auch ein noch unkalkulierbares Szenario. Trotzdem: Ich gebe solchen Geräten noch zehn Jahre – zehn Jahre, in denen allerdings viel passieren müsste.
Was sich ändern muss: Von der Technik bis zur Unternehmenskultur
Angefangen bei der Technik müssten beispielsweise Bewegungssensoren, GPS- und Bluetooth-Module so klein werden, dass sie sich alle zusammen in einem handlichen Gerät unterbringen lassen. Die Algorithmen, die im Hintergrund die Daten analysieren und verrechnen, müssten um ein Vielfaches genauer werden. Und: Apps müssten uns genau die Aufgaben abnehmen, bei denen Fehler passieren – die Eingabe von Mahlzeiten beispielsweise. Natürlich ist es auch heute schon möglich, jede Zutat fürs Abendessen auf das Gramm genau abzuwiegen und festzuhalten. Die Zeit und Geduld aber dürften nur die Allerwenigsten haben. Und: Apps müssten besser auf Nutzer-Bedürfnisse zugeschnitten sein. Unnötige, nervende oder zu komplizierte Funktionen werden schon heute kaum mehr geduldet.
Daneben aber müssten sich auch Arbeitgeber auf Veränderungen einstellen. Wenn ich Sport treibe, weil mir mein Smartphone sagt, dass es Zeit ist; wenn ich nicht mehr mit den Kollegen zu Mittag esse, sondern dann, wenn mir mein Smartphone sagt, dass es Zeit ist, dann verändern sich auch soziale Bereiche –und zwar radikal. Arbeit und Freizeit verwischen, Tages- und Arbeitsabläufe – bis vor wenigen Jahren noch fest zementiert – weichen auf. All das müssten Arbeitgeber mittragen. Sie müssten Unternehmensstrukturen verändern und zulassen, dass nicht mehr vorrangig sie bestimmen, wie der Tag ihrer Mitarbeiter aussieht, sondern eine App. Eine Hürde, die mit Blick auf den deutschen Mittelstand fast unüberwindbar scheint. Die Work-Life-Balance aber – der Zustand also, bei dem Arbeits- und Privatleben sich harmonisch verbinden –wäre ein Stück mehr Realität geworden.
Und nicht zuletzt sind solche Ideen auch eine große Herausforderung für den Datenschutz und den Umgang mit Big Data. Überlegt man, was für Mengen an hochsensiblen Daten schon bald gesammelt und ausgetauscht werden könnten, wird klar, wie viel hier noch zu tun ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass viele aktuelle Apps eine Anbindung an Soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter haben, braucht es aber wohl nicht nur sichere Datenverbindungen und Speicherlösungen, sondern auch ein neues Bewusstsein beim Nutzer.

Heute schon möglich: Die ePille von Proteus bezieht ihre Energie aus der Magensäure und übermittelt Daten an ein elektronisches Pflaster, das wiederrum Daten an eine App sendet.
Wichtig: Die Technik hinter den Apps hinterfragen
Das Bewusstsein des Nutzers aber ist auch heute schon gefordert, er darf nicht aufhören, die Technik, die beispielsweise hinter Kontext-sensitiven Apps und somit zum Teil auch hinter seinen Entscheidungen steckt, zu hinterfragen, sagt auch Publizist und Philosoph Jörg Friedrich: „Auch wenn wir nämlich glauben, dass Logik und Fakten den Empfehlungen des Services zugrunde liegen, können wir die Logik nicht mehr nachvollziehen, die Fakten nicht mehr prüfen. Somit ist das Ergebnis, der Entscheidungsvorschlag, uns vermutlich nicht mehr transparent.“ Friedrich hinterfragt vor allem, dass immer mehr Dienste, Apps und Gadgets uns vorgeben wollen, was wir tun sollen – nicht nur, „welchen Zug ich nehmen soll, sondern auch, welches Auto am besten zu mir passt, ob es meinen Lieblingswein gerade im Angebot gibt, ich ihn also heute kaufen soll, welche Partei ich wählen soll, ob ich für Atomkraft bin oder für neue Stromleitungen von Frankreich nach Deutschland“. Friedrich aber ist überzeugt, „dass man auch aus dem Vorliegen noch so vieler Fakten darüber, wie etwas tatsächlich ist, niemals ableiten kann, was jemand tun soll“ – das hänge immer von den persönlichen Wertvorstellungen, Präferenzen, moralischen Einstellungen, ästhetischen Vorlieben und vielen weiteren Faktoren ab.
Was er dabei übersieht: Auch Werte, Ästhetik und Moral sind durch die technische Entwicklung und Unternehmen wie Google, Facebook oder Apple mehr als nur einmal verändert worden. Noch in den 80er Jahren gab es groß angelegte Proteste gegen Volkszählungen, heute geben viele Nutzer teils sensible Daten freiwillig ab – an private Konzerne. Noch vor wenigen Jahren war das Skeuomorphic Design State of the Art, in kürzester Zeit aber ist es vom Flat Design abgelöst worden. Und die Debatten um das Urheberrecht zeigen, dass sich auch die Moral durch das Netz zu verändern scheint. Es ist also äußerst unwahrscheinlich, dass Quantified Self und Kontext nicht auch Einfluss auf unsere Gesellschaft haben werden.
Wie weitreichend dieser Einfluss sein wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Davon, wie schnell Entwickler bestehende Technologien miteinander verschmelzen können. Davon, wie ernst Unternehmen und Politiker Datenschutz zukünftig nehmen. Und davon, wie wir von Unternehmen zukünftig wahrgenommen werden: als Menschen – oder nur als Kunden.
 Florian Blaschke ist seit März 2013 Redaktionsleiter bei t3n.de. Davor hat er nach sechs Jahren als freier Journalist ein Tageszeitungsvolontariat absolviert, ein Nachrichtenportal mit aufgebaut und drei Jahre Station in der Unternehmens-PR gemacht. Er bloggt auf
Florian Blaschke ist seit März 2013 Redaktionsleiter bei t3n.de. Davor hat er nach sechs Jahren als freier Journalist ein Tageszeitungsvolontariat absolviert, ein Nachrichtenportal mit aufgebaut und drei Jahre Station in der Unternehmens-PR gemacht. Er bloggt auf 
Spannende Zeiten und sie werden noch spanndender wenn Kurzweil recht behält :)