Das perfekte Team: Wie du die richtigen Mitarbeiter zusammenbringst

(Grafik: t3n)
Er brauchte einen Moment, um sich zu sammeln. Nur wenige Minuten waren seit dem Schlusspfiff vergangen. Die deutsche U21-Mannschaft hatte gerade den Fußball-Europameistertitel geholt, als Nationaltrainer Stefan Kuntz gefragt wurde, was diese Nacht ihm und dem Team bedeute. Kuntz antwortete schließlich: „Jeder wollte diesen Pokal für das gesamte Team gewinnen. Das hat mir Sicherheit gegeben, dass wir einen guten Job machen werden. Es ist ein charakterlich perfektes Team.“
Ein perfektes Team – den Ausdruck hört und liest man oft. Nicht nur im Sport, sondern auch im Arbeitskontext. Aber was macht ein erfolgreiches Team eigentlich aus? Diese Frage beschäftigt Organisationspsychologen und andere Wissenschaftler schon seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Nach all den Jahren kristallisieren sich Erkenntnisse heraus, die manchmal sogar die Forscher selbst überraschen. Wieso eine Pizza helfen kann, warum das Bauchgefühl gefährlich ist und welche Rollen eine Führungskraft besetzen muss, erklären sich in unternehmensinternen Untersuchungen und wissenschaftlichen Studien.
Der bekannte Teamforscher Richard Hackman, bis zu seinem Tod 2013 Harvard-Professor für Sozial- und Organisationspsychologie, musste wegen seiner Forschung gar einen Buchtitel ändern. Aus dem geplanten Werk „Groups that work“ wurde „Groups that work (and those that don’t)“. Denn von den 33 Teams in so unterschiedlichen Berufen wie Leistungssportler, Top-Manager, Flugzeugcrew und Gefängniswächter „lagen leider die meisten im Bereich der Klammer“, wie Hackman berichtete. Sprich: Die Mitglieder funktionierten nicht zusammen.
Auch Google machte sich vor fünf Jahren auf die Suche nach einem Rezept für die perfekte Gruppe. Codename: Projekt Aristoteles. „Wir haben uns 180 Teams aus den verschiedensten Bereichen des Unternehmens angeschaut“, sagte die Managerin von Googles People-Analytics-Einheit, Abeer Dubey, nach Abschluss des Projekts der New York Times. Persönlichkeitszüge, Fähigkeiten, Führung – was ist wirklich wichtig? Über Monate, gar Jahre nahm Google nicht nur die hauseigenen Teams unter die Lupe, sondern durchforstete auch die Literatur.
Mit agilem Active Sourcing die richtigen Talente finden und binden – in unserem Recruiting-Guide erfährst du, wie es geht!
Teamgröße: Weniger ist mehr
Über einen Aspekt, auf den Google stieß, muss sich Fußballtrainer Kuntz keine Gedanken manchen: die Teamgröße. Seine Mannschaft hat immer elf Mitglieder. Basta. In Unternehmen ist das anders: Sie haben keine vorgegebene Teamgröße und müssen testen.
Gemäß der Logik „mehr Menschen gleich mehr Wissen“ ließe sich vermuten, dass große Teams erfolgreicher sind. Stichworte kollektive Intelligenz und die Weisheit der Vielen. Doch das gilt nur bedingt: Zu viele Teammitglieder können sogar schädlich sein. Denn je größer eine Gruppe, desto höher das Risiko, dass sich nicht mehr alle Mitglieder verantwortlich fühlen. „Manche Teammitglieder machen dann weniger, weil sie glauben, dass die Leistung der anderen schon genüge, um das Gruppenziel zu erreichen“, schreibt Conny Antoni, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Trier, in einem seiner Bücher. Solche Trittbrettfahrer legen sich dann in die sprichwörtliche Hängematte. Nicht umsonst gibt es den Kalauer „Team? Toll, ein anderer macht’s“. In großen Teams lässt sich zudem nicht mehr so einfach kommunizieren, die Strukturen werden unübersichtlich. Persönliche Sympathien sorgen dafür, dass sich fast automatisch Untergruppen bilden; Mobbing und Beziehungsstress nehmen zu.
Jeff Bezos lädt zu Meetings nur so viele Mitarbeiter ein, dass alle von zwei Pizzen satt werden.
Wie groß (oder klein) das optimale Team ist, hängt auch von der Teamaufgabe ab. Geht es einfach nur ums Ideenspinnen, etwa für eine neue Marketingkampagne oder die Gestaltung der Unternehmensräumlichkeiten, ist mehr Input generell besser – auch wenn die Größe natürlich im Verhältnis zum Diskussionsobjekt stehen sollte. Problematisch wird es bei Aufgaben mit nur einer richtigen Lösung, zum Beispiel, wenn der Bedarf an nötigem Lagerraum eingeschätzt werden muss. In solchen Fällen laufen Gruppen Gefahr, sich in ihrer Anfangsmeinung immer wieder zu bestätigen: Teammitglieder trauen sich nicht, abweichende Annahmen zu äußern, da sie die Harmonie wahren oder nicht als Abweichler gelten wollen. Oder sie glauben, dass sonst niemand ihre Meinung vertritt. Bei kreativen Gruppen führt ein solches Gruppendenken „nur“ zu weniger Ideen. Bei lösungssuchenden Gruppen aber unter Umständen zu drastischen Fehlentscheidungen.
Amazon-Gründer Jeff Bezos kennt die Problematik und hat eine Lösung gefunden: die Zwei-Pizza-Regel. Zu Meetings lässt er nur so viele Mitarbeiter zusammenkommen, dass sie von zwei geteilten Pizzen satt werden. Etwas genauer haben Wissenschaftler der Medizinischen Universität Wien die maximale Teamgröße beziffert. Am Beispiel von Regierungskabinetten haben sie festgestellt, dass es ab mehr als 20 Mitgliedern besonders heikel wird. Eine Zahl, die schon vorher in der Wissenschaft auftauchte, beispielsweise für Teams in der Gesundheitswirtschaft.
Erfolgreiche Unternehmen wachsen aber nun mal. Was also tun? Einige Startups, die trotz Skalierung ihre Startup-Mentalität wahren wollen, halten ihre Teams bewusst klein. Spotify hat seine Mitarbeiter in „Squads“ von etwa fünf bis acht Personen eingeteilt. Die Squads agieren eigenverantwortlich und sind sozusagen Startups im Startup.
Diese Form der Selbstverwaltung ist in vielen Gruppen förderlich – vorausgesetzt, das Team ist gut vorbereitet und fühlt sich damit wohl. Das hat der US-amerikanische Professor Greg L. Stewart in einer Auswertung von 93 Studien festgestellt. „Teams profitieren davon, mehr Informationen und größere Entscheidungsfreiheit zu haben“, so Stewart.
Fragt die Kollegen!
Selbstverwaltung und Teamgröße sind aber nur zwei Stellschrauben, die ein Team gut funktionieren lassen. Personaler können an der dritten drehen: der richtigen Mitarbeiterauswahl. Denn es gibt tatsächlich so etwas wie besonders teamfähige Menschen – und die gilt es zu identifizieren.
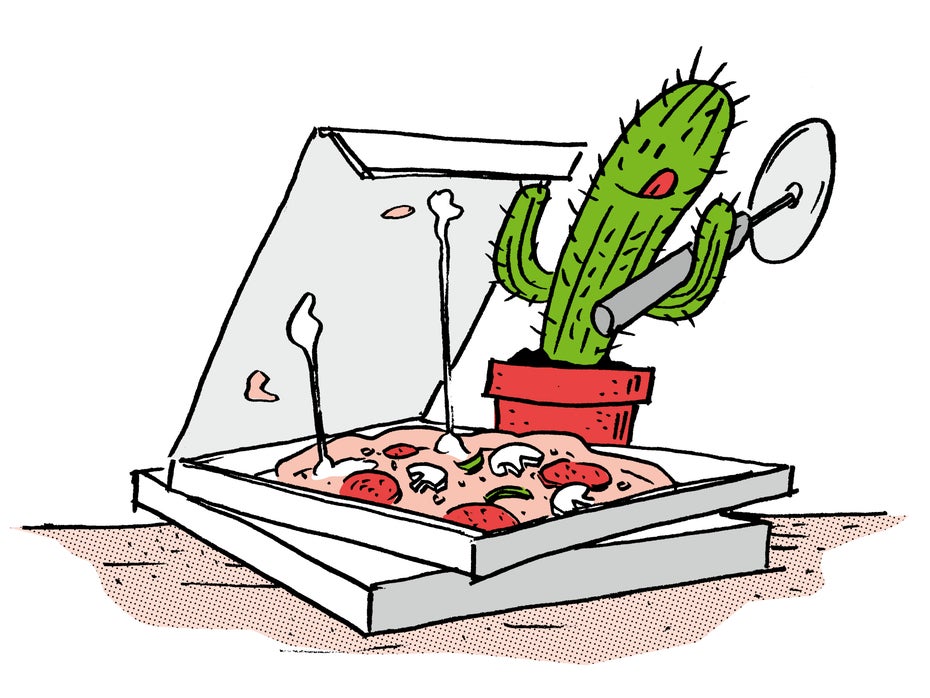
Die Psychologie unterscheidet fünf grundlegende Persönlichkeitsmerkmale, Big Five genannt: Extraversion beschreibt gesellige, energetische und optimistische Persönlichkeitszüge. Verträglichkeit zeigt an, wie hilfsbereit, kooperativ und warmherzig jemand ist. Zur Gewissenhaftigkeit zählen Verlässlichkeit, Ausdauer und Ambitioniertheit. Viel Offenheit haben besonders neugierige, aufgeschlossene und fantasievolle Leute und emotionale Stabilität bezieht sich darauf, ob jemand gelassen, sicher und nicht neurotisch ist.
Für den Teamerfolg haben sich Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit als besonders wichtig herausgestellt. „Auf den Teamerfolg wirken sie sich noch stärker aus als auf den individuellen Berufserfolg“, hat die Organisationspsychologin Suzanne Bell herausgefunden. Auch emotionale Stabilität und ein gewisses Maß an Extraversion scheinen Teamerfolg zu begünstigen. Die viel angepriesene emotionale Intelligenz kann sich hingegen auch negativ auswirken. Wer sich gut in andere einfühlt, kann auch manipulativ sein und damit die Atmosphäre im Team vergiften.
Wie lässt sich diese Teamfähigkeit nun beim Einstellungsgespräch erkennen? Jedenfalls nicht daran, dass die Bewerbungsmappe frei von Eselsohren und Rechtschreibfehlern ist oder jemand Teamsport als Hobby angibt, sagt Uwe Kanning, Professor an der Hochschule Osnabrück. Seit Jahren kritisiert der Wirtschaftspsychologe die aktuelle Praxis bei der Personalauswahl, unter anderem in Büchern wie „50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden“. Er bezeichnet Deutschland in Sachen Personalauswahl als „Entwicklungsland“. „Personaler legen zu viel Wert auf die Bewerbungsmappe und das Bauchgefühl, aber zu wenig auf strukturierte und gut vorbereitete Interviewleitfäden oder gar auf wissenschaftlich bestätigte Tests, etwa zum IQ oder den genannten Big Five“, sagt Kanning.
Für seine Kritik gibt es einen guten Grund: Das Bauchgefühl kann in die Irre führen. Zum Beispiel, weil gutaussehende Menschen auf die meisten Menschen automatisch auch intelligenter, teamfähiger, motivierter wirken. Das Bauchgefühl sollten Personaler erst zurate ziehen, wenn am Ende zwei oder drei gleich gut geeignete Kandidaten oder Kandidatinnen übrig bleiben, rät Kanning. „Dann ist es völlig legitim, denjenigen zu nehmen, der sympathischer ist.“ Doch bitte nicht direkt am Anfang der Intuition folgen. Dann rede man sich einen Kandidaten schön.
Um der eigenen Küchenpsychologie vorzubeugen, rät Kanning unter anderem zu E-Assessments vor dem Bewerbungsgespräch. Ein Computer, der Aufgaben evaluiert, ohne Anschreiben und Fotos der Bewerber zu kennen, lasse sich weniger von Oberflächlichkeiten täuschen. „Die Potenziale des E-Recruting und E-Assessment werden in Deutschland leider noch viel zu wenig genutzt“, sagt Kanning.
Nicht nur Kuschler
Entscheidend ist aber nicht nur, ob ein Kandidat die perfekten Eigenschaften mitbringt, sondern ob er die anderen Mitglieder auch ergänzt. „Team Profile Model“ nennt das John Mathieu, Professor für Team-Psychologie. Das sei besser, als sich nur auf die Talente der Bewerber zu fokussieren. „Unter dem Strich gibt es keine Garantie, dass individuell talentierte Mitglieder ein effektives Team bilden,“ sagt Mathieu. Trainer Ottmar Hitzfeld hat es einst so formuliert: „Es spielen nicht immer die elf Besten, sondern die beste Elf.“ Sprich: Eigenschaften, die bei einem Bewerber gut sind, müssen nicht unbedingt für das ganze Team gut sein.
Wirtschaftspsychologe Kanning ruft dazu auf, vor jedem Bewerbungsgespräch eine genaue Anforderungsanalyse zu erstellen. Welche Fähigkeiten braucht der künftige Stelleninhaber für genau diesen Job? In welcher Situation braucht das Team Hilfe, und was sollte der oder die Neue am besten tun? „Um das zu erfahren, müssen Sie auch mit den anderen Teammitgliedern sprechen, also den künftigen Kolleginnen und Kollegen, und nicht nur mit Vorgesetzten“, sagt Kanning. Nur so bekäme man heraus, wie ein Team ticke und wer hineinpasse.
Einer, der diesen Rat schon beherzigt, ist Sebastian Herzog. Der 34-Jährige hat den Innovation Hub der Lufthansa aufgebaut, ein eigenes Startup namens Officepunk gegründet und als freier Berater Unternehmen bei der Digitalisierung zur Seite gestanden – alles parallel. Nun hat Herzog den Lufthansa-Job geschmissen und sitzt im Management von Hy. Das ist eine Dienstleistungs-GmbH im Besitz des Axel-Springer-Konzerns, die Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen will. Für die Firma sucht Herzog neue Mitarbeiter – und setzt dabei auf die von Kanning erwähnte Methode: Vor einer finalen Zusage träfen stets mindestens drei Teammitglieder den Bewerber. „Wenn das Team Bedenken hat, werde ich denjenigen nicht einstellen“, sagt Herzog. Für den Digitalstrategen ist das Team auch ein Korrektiv, um sich nicht vom eigenen Bauchgefühl in die Irre führen zu lassen.
Das Team nicht nur beim Stellenprofil einzubeziehen, sondern auch bei der Auswahl, kann die Personalauswahl allerdings auch verkomplizieren. Denn was ist, wenn sich Team und Führung nicht auf einen Kandidaten einigen können? Etwa, weil ein Teammitglied versucht, die eigene Machtposition zu sichern? Für Herzog ist das keine Frage: „If in doubt, then don’t.“ Bei Zweifeln wird die Person nicht eingestellt.
Denn wer für eine Gruppe mehrere sehr talentierte Leute auswählt, läuft Gefahr, dass sie sich um die Position als Alphatier rangeln. „Zu viel Talent“-Effekt nennen das der Sozialpsychologe Adam Galinsky und der Ökonom Maurice Schweitzer. Gleiches gilt für ein Übermaß anderer positiver Eigenschaften: Sind alle Teammitglieder extrem kooperativ und verträglich, kritisieren sie sich nie wirklich und Fehlerquellen bleiben lange unbemerkt. Sind alle sehr gewissenhaft, strebt das Team nach Perfektion und schließt das Projekt nie ab. Daher braucht es manchmal einen Quergeist und nicht nur Kuscher und Kuschler.
Organisationspsychologen glauben auch deshalb nicht mehr nur an Teammitglieder, die das Wohl der Gruppe über alles stellen. Manchmal hilft es sogar, eher individualistische Teammitglieder zu engagieren. Das kann die Kreativität fördern, wie die US-amerikanischen Forscher Jack Goncalo und Barry Staw herausgefunden haben. „Eine individualistische Orientierung kann Gruppen helfen, Innovationen am Arbeitsplatz voranzutreiben“, schlussfolgern die beiden. Auch Wissenschaftler der Uni Tübingen plädieren in Gruppen für „Coopetition“: sowohl Kooperation als auch Konkurrenz.
Wie sinnvoll sind Teamrollen?
Um die richtigen Leute zusammen in eine Gruppe zu stecken, sollen Teamrollen helfen. Zumindest in der Theorie. Da gibt es zum Beispiel den Macher, den Koordinator und den Finisher.
Oder den Spezialisten, den Ermutiger und den Informationsgeber. Oder den Kritiker, den Erneuerer und den Herausforderer. In Scrum-Teams sind wiederum Product-Owner, Entwicklungsteam und Scrum-Master als feste Größen vorgesehen. Durch die Teamrollen ließen sich verschiedene Persönlichkeiten nutzen, so die Logik.
Das Bedürfnis, einem Teammitglied eine Rolle zuzuordnen, hat rund 23 verschiedene Typologien mit insgesamt 164 Rollen hervorgebracht, wie Forscher kürzlich in einem Überblicksartikel schrieben. Am bekanntesten sind die neun Rollen des Briten Meredith Belbin: Er unterscheidet zwischen Erfinder, Wegbereiter, Macher, Umsetzer, Teamarbeiter, Spezialist, Perfektionist, Beobachter und Koordinator.
Aber Typologien sind kein Allheilmittel. Selbst Belbins Teamrollen sind wissenschaftlich umstritten. Gleiches gilt für die in Personalabteilungen beliebte Myers-Briggs-Persönlichkeitstypologie. „Unternehmen müssen aufpassen, nicht irgendwelchen Beratern aufzusitzen, die immer wieder Neues versprechen, ohne dass es wissenschaftlich validiert ist“, sagt Wirtschaftspsychologe Kanning. Ständig käme jemand mit irgendeiner neuen Typologie oder ähnlichem um die Ecke und die Unternehmen riefen: „Toll, das machen wir jetzt auch!“
Eine solche neue Typologie hat gerade erst Deloitte hervorgebracht. Im Juni-Heft des Harvard Business Managers durfte das Beratungsunternehmen seine Teamrollen voll ausbreiten: „Pioniere, Macher, Integratoren und Wächter: Lernen Sie, aus vier unterschiedlichen Arbeitsstilen den richtigen Teammix zusammenzustellen.“ Anders als so manche Typologie versucht Deloitte zwar, eine wissenschaftliche Grundlage heranzuziehen: Sie beruht auf den vier Temperamentstilen, die die Anthropologin Helen Fisher entdeckt haben will und sich auf die chemischen Vorgänge im Gehirn stützt. Daher nennt Deloitte das Vier-Typen-System auch „Business-Chemistry“. Klingt super: Was neurologisch fundiert ist, muss doch stimmen! Allerdings hat Fisher die Temperamente eigentlich für die Liebe entwickelt, nicht für den Geschäftsbereich. Und in der Wissenschaft wurde ihre Theorie bislang kaum aufgegriffen.

Dabei ist die Idee von Teamrollen nicht zwingend Humbug. Aber sie ist mit Vorsicht zu genießen. „Leute anhand ihrer Persönlichkeiten feste Rollen zuzuschreiben, kann zu Rigidität führen“, sagt der kanadische Psychologe und HR-Berater Mitch McCrimmon. Jeder fühle sich nur noch für die eigene Aufgabe verantwortlich und unterdrücke kluge Ideen und Anmerkungen, um anderen Teammitgliedern nicht ins Revier zu pfuschen. Und: Was macht man eigentlich, wenn das Team so klein ist, dass jedes Mitglied mehrere Rollen übernehmen muss, oder so groß, dass mehrere Mitglieder dieselbe Rolle haben? Dann können Typologien zu mehr Konflikten führen, statt dass sie die Zusammenarbeit vereinfachen, meint McCrimmon.
Wie viel Mischung wirklich gut ist
Ganz ähnlich ist es mit der Idee der Diversität. Wie ein Heilsbringer wird die Vielfalt vermarktet. Gemischte Teams aus Männern und Frauen führen besser, kulturell verschiedene Gruppen aus Einheimischen und Migranten seien besonders kreativ und Teams, in denen junge und alte Mitarbeiter voneinander lernen, besonders erfolgreich. Doch Achtung: Diversität ist ein zweischneidiges Schwert, wie inzwischen fast alle Wissenschaftler sagen.
Grundsätzlich gilt: Wenn die Mitglieder unterschiedliche Berufe und fachliche Hintergründe haben – wie es beispielsweise auch im Design Thinking vorgesehen ist, es also eine „funktionale Diversität“ gibt –, kann sich das durchaus positiv auswirken. Vielfalt kann etwa Gruppendenken entgegentreten und einem Tunnelblick vorbeugen. Teams mit sehr unterschiedlichen Menschen können daher tatsächlich kreativer sein, gerade bei kurzlebigen Projekten.
Anders ist es laut Studien allerdings bei Teams, die über einen langen Zeitraum zusammenarbeiten. Denn wo unterschiedliche Menschen aufeinander treffen, kommt es eher zu Streit und Missverständnissen. Der Zusammenhalt leidet, wie eine Untersuchung der University of Central Florida zeigt. Für die Doktorarbeit wurden 342 verschiedene Studien ausgewertet. Besonders Diversität in Werten und Einstellungen wirkt sich demnach negativ aus. Aber auch Unterschiede in demografischen Merkmalen wie Ethnie, Alter und Geschlecht seien kontraproduktiv. Mit Diversität ist es daher wie mit der mittelalterlichen Quecksilber-Therapie: Sie begünstigen das Gegenteil vom Beabsichtigten.
„Es spielen nicht immer die elf Besten, sondern die beste Elf.“
Die Chance, dass Vielfalt Vorteile bringt – oder zumindest keine Nachteile –, lässt sich in der Personalauswahl deutlich erhöhen. „Damit ein Team trotz Heterogenität nicht in Untergruppen zerfällt, sollte es keine natürlichen Subgruppen enthalten“, meint Kanning. Für ein Vierer-Team zum Beispiel wäre es unklug, zwei Frauen im Alter von Mitte 40 und zwei Männer Mitte 20 auszuwählen, besser eigne sich je eine Frau und ein Mann in jeder Altersklasse.
Ob Vor- oder Nachteile überwiegen, hängt aber auch davon ab, wie das Team mit der Vielfalt umgeht. Sieht das Team Diversität als etwas Positives oder nur als notwendiges Übel – etwa durch eine Quote? Halten die Teammitglieder zusammen und identifizieren sich mit dem gemeinsamen Ziel? Haben alle gleich lange Redezeiten? Was in der Theorie schön erdacht ist, muss am Ende im Alltag standhalten.
Keine Angst vor Bloßstellung
Wenn ein Unternehmen auf all diese Faktoren geachtet hat, ist die Chance groß, dass die Kollegen gut miteinander auskommen – und dass das Team tatsächlich gemeinsam Erfolg hat. Und damit kommen wir endlich zurück zu Googles „Projekt Aristoteles“. Denn genau zu diesem Fazit kam auch der US-Konzern nach fünf Jahren Teamanalyse und Literatursuche: Es kommt vor allem darauf an, wie die Kollegen miteinander umgehen. „Googles Daten ließen erkennen, dass psychologische Sicherheit ausschlaggebend ist“, heißt es bei der New York Times. Psychologische Sicherheit ist ein Ausdruck, den die Harvard-Professorin Amy Edmondson geprägt hat. Darunter versteht sie, angstfrei auf zwischenmenschliche Risiken eingehen zu können, besonders am Arbeitsplatz. In einem sicheren Team können die Mitglieder darauf vertrauen, nicht ausgelacht, gemobbt oder im Wort beschnitten zu werden, wenn sie mit Ideen und Kritik rausrücken oder Fehler zugeben. Daher kommunizieren sie mehr miteinander, eine Fehlerkultur entsteht. „Psychologische Sicherheit ermöglicht Teams und Organisationen zu lernen“, sagt Edmondson.
Neu ist Googles Erkenntnis dementsprechend nicht, jedenfalls nicht in der Wissenschaft. Britische Psychologen haben schon Anfang der 1990er Jahre ein heute weit verbreitetes „Team Climate Inventory“ konzipiert und dabei Sicherheit als „den besten Prädiktor für die Anzahl der Innovationen in einem Team“ ausgemacht. 2003 bestätigten Wissenschaftler der Uni Gießen anhand 43 mittelständischer Unternehmen in Deutschland, dass psychologische Sicherheit dazu beiträgt, dass die Firmen ihre Ziele erreichen. Daher kommen viele Studien wie die erwähnte Doktorarbeit aus Florida zu dem Schluss: „Der Schwerpunkt sollte weniger auf der Teamauswahl und -zusammensetzung liegen als vielmehr darauf, sicherzustellen, dass sich im Team die entscheidenden Verhaltensweisen entwickeln.“
Den gleichen Ratschlag entwickelte auch der Teamforscher Hackman, als er schließlich erkannte, warum so viele Kollegen oder Mitarbeiter nicht gemeinsam funktionieren: „Wenn ein Team erst einmal zusammengestellt ist und seine Aufgabe bekommen hat, glauben Manager manchmal, ihr Job sei getan.“ Aber das sei ein Fehler. Für den Harvard-Professor war es daher zeitlebens wichtig, Teamcoaching voranzutreiben. Wie im Fußball zählt also nicht nur die „beste Elf“, sondern auch die Führungskraft dahinter.

