Startup-Finanzierung: Warum kriegen Frauen so viel weniger Geld?

Juniqe-Geschäftsführerin Lea Lange hat mit zwei Männern gegründet. Mit dem diversen Team hat sie positive Erfahrungen gemacht. Sie glaubt, dass viele Frauen ihre Gründungen von Anfang an eher kleiner denken. (Foto: Juniqe)
Im Rückblick wirkt es schwer nachvollziehbar, dass Gründerin Anke Odrig mit ihrem Finanzierungsvorhaben im ersten Anlauf scheiterte. Odrig ist Geschäftsführerin der Firma Little Bird, sie hat eine Software für die Vergabe von Kitaplätzen entwickelt. Auf ihrem Portal können Eltern sehen, in welchen Betreuungseinrichtungen in ihrer Nähe es noch freie Plätze gibt. Knapp 100 Kommunen nutzen das Programm schon und sparen sich so teure Eigenentwicklungen. Dafür wurde die 44-Jährige mittlerweile unter anderem für den Deutschen Gründerpreis nominiert und kürzlich von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zur „Vorbildunternehmerin“ ernannt. Kurzum: Die Unternehmerin hat viel erreicht.
Als sie ihr Konzept aber 2009 erstmals bei potenziellen Geldgebern, in diesem Fall einer staatlichen Investitionsbank, vorstellte, würdigten es die Berater nur eines kurzen Blickes. Wie Odrig später erfuhr, schätzten sie ihre Idee zunächst als lediglich „weiteres Onlineratgeberportal für Mütter“ ein – und lehnten ab.
Die Erfahrung von Anke Odrig ist kein Einzelfall: Die Kapitalsuche ist für Gründerinnen eine viel größere Herausforderung als für Gründer, das belegen gleich mehrere Studien. Der Accelerator Masschallenge und die Unternehmensberatung BCG etwa verglichen im Juni vergangenen Jahres 350 Startups aus der ganzen Welt und stellten fest: Rein männliche Gründungsteams bekamen im Schnitt 2,12 Millionen US-Dollar von Investoren. Gründerinnen und gemischte Teams dagegen nur 935.000 Dollar – weniger als die Hälfte. Blickt man nach Europa, kommt der Londoner Venturecapital-Geber Atomico in seiner Studie „State of European Tech“ zu ganz ähnlichen Ergebnissen: Demnach gab zwar die große Mehrheit der befragten Gründer und Investoren in der europäischen Techszene an, dass Diversität im Gründerteam sehr wichtig sei für den unternehmerischen Erfolg, de facto flossen aber 2018 nur zwei Prozent des Risikokapitals in von Frauen gegründete Startups und sieben Prozent in gemischte Teams. Die restlichen 91 Prozent des Kapitals bekamen Gründer.

„Ich denke, dass Frauen bei Pitches im Schnitt zurückhaltender auftreten als Männer. Und viele denken bei ihren Gründungen vermutlich von Anfang an kleiner.“
Lea Lange, Gründerin, Juniqe
Auch in Europa klaffen also Anspruch und Realität auseinander. Die europäische Techbranche ist ebenso wie die amerikanische in großen Teilen homogen, sprich: jung, weiß und männlich. Gründerinnen dagegen sind in den großen Wagniskapitalrunden stark unterrepräsentiert. Von den Startups, die im vergangenen Jahr größere Investments abschlossen, hatten gerade einmal ein Prozent der Unternehmen eine weibliche CTO an der Spitze. „Es gibt ein schockierendes Ungleichgewicht im Kapitalfluss an männliche im Vergleich zu weiblichen Gründern“, lautet dementsprechend auch das harte Fazit der Studienautoren von Atomico.
Wer der Ursache für das enorme Missverhältnis bei der Kapitalvergabe auf den Grund gehen will, landet schnell bei der Frage nach – bewussten oder unbewussten – Vorurteilen gegenüber weiblichen Unternehmern. So auch Anke Odrig von Little Bird, die rückblickend sagt: „Ich glaube, mir als Frau wurde so eine IT-lastige Geschäftsidee einfach gar nicht zugetraut.“ Erst als Odrigs Berater, der sie bei der Kapitalsuche unterstützte, darauf hinwies, dass die damals noch alleinerziehende Mutter mitnichten irgendein Ratgeberportal, sondern eine neuartige IT-Infrastruktur für Kommunen entwickeln wolle, fiel auch den Geldgebern dieser Unterschied auf.
Vorurteile halten sich hartnäckig
Schwedische Wissenschaftler beobachteten zwischen 2009 und 2010 sieben Venturecapital-Firmen dabei, wie diese über Bewerbungen von Startups diskutierten und konnten dabei ebenfalls deutliche Vorurteile feststellen: Während junge Frauen von den Investoren oft als unerfahren eingestuft wurden, galten junge Männer als erfolgshungrig und aufstrebend. Vorsicht wiederum wurde bei Gründerinnen als hemmende Angst ausgelegt, bei Männern dagegen als wünschenswerte Besonnenheit. Laut einer Studie der Universitäten Harvard und Columbia von 2018 fragen Geldgeber männliche Kandidaten, wie sie ihr Startup zum Wachsen bringen wollen, Frauen dagegen häufiger, wie sie ein Scheitern verhindern wollen.
Dass Investoren Gründer und Gründerinnen unterschiedlich behandeln, ist also ein gewichtiger Faktor, der die Suche nach Startkapital für weibliche Gründer enorm erschweren kann. Allerdings: Im Gespräch mit Gründerinnen und Geldgebern zeigt sich, dass solche Rollenbilder und Vorurteile nicht der einzige Grund für die ungleiche Kapitalvergabe sind.
Anke Odrig etwa hat inzwischen viel Erfahrung mit Geldgebern. Nachdem sie dank der Intervention ihres Beraters letztlich doch noch mit einer Anschubfinanzierung der Landesbank gestartet war, stieg der Social Venture Fund Ananda bei Little Bird ein. Inzwischen hat Russmedia International, der Investmentarm des gleichnamigen österreichischen Medienkonzerns, die Mehrheit übernommen. Odrig erlebt zwar im Alltag immer noch regelmäßig, dass sie als Geschäftsführerin anders behandelt wird: Etwa, wenn ihre Ideen in Kundengesprächen erst durchkommen, wenn ein Kollege sie wiederholt. Oder wenn Kunden beim Besuch ihrer Firma erst ihre Angestellten begrüßen. Zumindest bei der Kapitalsuche aber habe ihr Geschlecht später nie wieder einen Unterschied gemacht, sagt sie: „Der Start war schwieriger, aber danach haben die Investoren nur noch auf die Zahlen geachtet.“
Diese Erfahrung teilt auch Lea Lange. Die 31-Jährige ist die Gründerin des Berliner Onlinekunsthändlers Juniqe. Lange führt durch ein lichtdurchflutetes Großraumbüro, in dem rund 80 junge Menschen in die Tasten tippen. Die Wände sind – natürlich – mit Bildern aus der eigenen Kollektion dekoriert. Über 20 Millionen Euro Wachstumskapital hat Lange gemeinsam mit ihren Mitgründern Marc Pohl und Sebastian Hasebrink seit der Gründung im Jahr 2014 bereits eingesammelt. Schlechte Erfahrung mit Investoren habe sie dabei nie gemacht, sagt sie: „Bei uns wurde es eher sogar positiv aufgefasst, dass wir ein gemischtes Gründerteam waren.“
Auf die Frage, wieso Gründerinnen und gemischte Teams dann im Schnitt so viel weniger Kapital bekommen, überlegt sie kurz und sagt dann: „Ich denke, dass Frauen bei Pitches im Schnitt zurückhaltender auftreten als Männer. Und viele denken bei ihren Gründungen vermutlich von Anfang an kleiner und streben nicht gleich nach der Weltherrschaft.“ Dass Lange damit richtig liegen könnte, lassen Zahlen aus dem Female Founders Monitor 2019 vermuten, einer Studie über deutsche Gründerinnen. Ihr zufolge suchen überhaupt nur gut 41 Prozent aller Gründerinnen Geldgeber. Das sind zwar schon deutlich mehr als ein Jahr zuvor (FFM 2018: 30,3 Prozent), aber immer noch deutlich weniger als bei männlichen Gründern (53,2 Prozent). Auch planen Gründer demnach deutlich häufiger die Expansion ins Ausland. Starkes Wachstum und der Aufstieg zum Unicorn scheinen also bei vielen Unternehmerinnen nicht ganz oben auf der Prioritätenliste zu stehen.
Dazu kommt, dass Frauen oft in anderen Branchen gründen als Männer, auch das zeigt der Female Founders Monitor. Demnach zieht es Gründerinnen seltener in Bereiche wie IT, Software as a Service oder industrielle Hardware. „Wir als Technologieinvestor sehen in diesem Bereich per se deutlich weniger Gründerinnen“, sagt Tanja Emmerling vom High-Tech Gründerfonds (HTGF), einem der größten Fonds in Deutschland. Stattdessen gründen Frauen im E-Commerce, bauen Agenturen auf oder bieten Dienstleistungen an: konzentrieren sich also oft auf Geschäftsideen, die weniger kapitalintensiv sind. Die Suche nach einem Investor ist für sie daher gar nicht nötig.

„Ich will, dass es mein Business bleibt und meine freie Entscheidung: ,Mache ich das so oder so?‘“ Meike Haagmans, Gründerin, Joventour (Foto: Joventour/Lynn Marie Zapp)
Auch Meike Haagmans hat sich ganz bewusst gegen einen Investor in ihrem Unternehmen entschieden. Die Düsseldorferin hat den Reiseveranstalter Joventour gegründet und plant für ihre Kunden Reisen in Asien und Südamerika, bei denen für den Transport lokale Fernbusse genutzt werden. Organisiertes Backpacking quasi. Haagmans hat die Firma 2012 mit 4.000 Euro privatem Startkapital gegründet und seitdem aus den laufenden Einnahmen heraus aufgebaut. Fünf Angestellte hat sie inzwischen, ihr Umsatz liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Auf ihrer Prioritätenliste ganz oben steht nicht schnelles Wachstum, sondern vor allem ihre persönliche Freiheit: „Ich will, dass es mein Business bleibt und meine freie Entscheidung: ,Mache ich das so oder so?‘“
Haagmans hat ihr Unternehmen in Teilzeit aufgebaut, arbeitet nebenher als Flugbegleiterin. Die 38-Jährige wirkt gut gelaunt, souverän und gelassen. Man kann sich gut vorstellen, wie sie selbst als Backpackerin durch Südamerika zog. Eine Zeit lang habe sie überlegt, externes Kapital aufzunehmen, erzählt sie. Zum Beispiel, um mehr Mitarbeiter fürs Marketing einstellen zu können. Nach einigen Gesprächen mit möglichen Geldgebern aber verwarf die Gründerin die Idee: „Deren Ziele passten nicht zu meinen.“ Eine Investorin etwa empfahl ihr, nur noch auf kostengünstigen, digitalen Vertrieb zu setzen statt auf persönliche Kundenberatung. Kommt nicht in Frage, antwortete Haagmans damals. Bei befreundeten Gründerinnen erlebe sie, wie diese der Druck durch ihre Investoren belaste: „Ich bin mir sicher, dass das bei mir ähnlich wäre.“
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Wie schwierig es sein kann, ein schnell wachsendes Startup, die Erwartungen von Geldgebern und das eigene Familienleben unter einen Hut zu bringen, erlebt Lina Wüller von Ovy derzeit. Gemeinsam mit ihrer Schwester Eva hat die Gründerin eine Zyklus-App mit Thermometer entwickelt und mehrere Investoren für ihr Vorhaben gewonnen. Vor wenigen Monaten ist sie Mutter geworden, sechs Wochen nach der Geburt saß sie wieder am Schreibtisch. „Ich verstehe Frauen, die sich diesen Spagat nicht antun wollen“, sagt Lina Wüller. Weil auch ihr Partner in Vollzeit arbeitet, hat sich das Paar eine Nanny geholt, die Wüller auch bei Geschäftsreisen begleitet. „Das geht schon alles“, sagt sie. „Aber es ist aufreibend. Man hat echten Druck von zwei Seiten: privat und geschäftlich.“
Um es für Frauen attraktiver zu machen, auch große, schnell wachsende Firmen aufzubauen, müsse die Unterstützung für Mütter in solchen Situationen deutlich besser werden, sagt Wüller. Derzeit gilt etwa für Gründerinnen, die ihr Geschäft selbst führen und Anteile am Unternehmen halten, kein Mutterschutz. Eigene Betriebskitas aufzubauen, ist für Startups wegen der hohen gesetzlichen Auflagen schwierig. Und die Zuschüsse, die man für Nannys beantragen könne, seien vergleichsweise gering, sagt Wüller. „Wir brauchen eine offenere Debatte darüber, wie sich die Gründung eines auf Wachstum ausgerichteten, kapitalintensiven Startups mit einer Mutterschaft vereinbaren lässt“, fordert Lina Wüller.

„Wir brauchen eine offenere Debatte darüber, wie sich die Gründung eines auf Wachstum ausgerichteten, kapitalintensiven Startups mit einer Mutterschaft vereinbaren lässt.“ Lina Wüller, Gründerin, Ovy (Foto: Ovy)
Die Frage, wie man mehr Wagniskapital zu den Gründerinnen oder umgekehrt die Gründerinnen zum Kapital bekommt, hat zuletzt stark an Bedeutung gewonnen. In den USA zum Beispiel heißen die Wortführerinnen dieser Debatte Shelly Porges und Sarah Chen. Die Unternehmerinnen haben den „Billion Dollar Fund for Women“ gegründet und wollen binnen eines Jahrzehnts rund eine Milliarde US-Dollar für Gründerinnen einwerben. Auch für Porges und Chen ist klar, dass es verschiedene Gründe sind, die zur ungleichen Vergabe von Wagniskapital führen. Eine große Rolle aber spiele Vertrauen, argumentieren sie. So unterstützten Investoren gerne Gründer, die ähnlich tickten wie sie selbst und deren Entscheidungen sie nachvollziehen könnten. Oft genug bekämen sie solche Leute auch über ihr persönliches, oft männerdominiertes Netzwerk empfohlen – ein weiteres Vertrauenssiegel. Mit ihrer Initiative wollen Porges und Chen nun ein Zeichen setzen und Aufmerksamkeit für das Thema schaffen: So wie über den Gender Pay Gap müsse auch die Investmentlücke deutlich mehr debattiert werden, fordern sie.
Ähnliche Initiativen entstehen aktuell in Deutschland. Der Software-Konzern SAP hat sich vorgenommen, mindestens 40 Prozent des Kapitals aus seinem hauseigenen Investmentfonds künftig an unterrepräsentierte Gruppen wie Frauen auszuzahlen. Alexa Gormann, die den Fonds verantwortet, will dabei auch das Auswahlverfahren fairer gestalten – und unter anderem darauf achten, dass Gründerinnen und Gründer im Bewerbungsprozess die gleichen Fragen hören. Gormann stellt klar, dass das nicht aus reiner Nächstenliebe geschehe: „Für uns ist klar: Diverse Gründerteams sind erfolgreicher.“ So hätten weiblich-männliche Teams im Schnitt bessere Ideen und erwirtschafteten eine höhere Rendite.
Es braucht mehr Investorinnen
Christian Miele, Partner beim Berliner Wagniskapitalgeber Eventures, glaubt, dass sich in der VC-Szene noch mehr ändern muss. Der junge Familienvater ist mit vielen deutschen Gründeri nnen befreundet oder gut bekannt und macht sich viele Gedanken darüber, wie man Frauen die Kapitalsuche leichter machen kann. „Vor allem brauchen wir mehr Investorinnen“, sagt Miele. „Da haben wir ein echtes Defizit.“ Das Manager Magazin hat kürzlich die Web- und Linkedin-Seite von 30 privaten Technologieinvestoren in Deutschland analysiert und festgestellt: Nur 3,2 Prozent der Partnerpositionen sind mit Frauen besetzt. Immerhin investierten derzeit viele Fonds in den Aufbau weiblicher Nachwuchstalente, sagt Miele: „Das Bewusstsein in der Branche für dieses Missverhältnis ist auf jeden Fall da.“
Auch Tanja Emmerling vom High-Tech Gründerfonds geht davon aus, dass die Einstiegschancen für Frauen in der VC-Szene durchaus gut sind. Noch sei die Branche zwar stark männerdominiert, weil auch viele Fonds aus eher männlich geprägten Unternehmernetzwerken heraus entstünden, sagt sie. Sie habe aber dennoch als Frau nie Nachteile gehabt. „Ich fände es wichtig, dass mehr erfolgreiche Unternehmerinnen eigene Fonds aufsetzen – und so auch Vorbilder schaffen für junge Frauen, die zeigen, dass dieser Job durchaus attraktiv sein kann.“
Trotz aller Änderungen, die in der Investorenszene nötig seien, müsse sich aus ihrer Sicht aber vor allem auch die Denkweise von Frauen selbst ändern, sagt Little-Bird-Gründerin Anke Odrig. Wenn die Gesellschaft mehr Gründerinnen haben wolle, die große Unternehmen aufbauen, müsse man Frauen dazu ermutigen, dieses Ziel häufiger auf ihre Agenda zu setzen: „Frauen müssen noch viel stärker lernen, sich selbst mehr zuzutrauen, größer zu denken.“






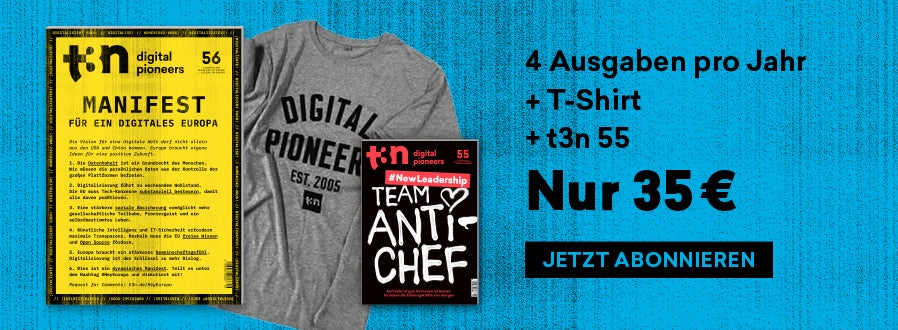

Ja……der Kinderwunsch…….Die meiste Zeit haben Menschen Kinder bekommen, weil es sich nicht vermeiden ließ; heutzutage pilgern unsere ungewollt Kinderlose zu den günstigen ukrainischen Kiwu-Kliniken, weil dort ein viel besser Service als in der Heimat angeboten wird. Wenn man entscheiden konnte, haben Menschen dann Kinder bekommen, weil sie welche wollten, oder wenn sie als Arbeitskraft und Altersvorsorge notwendig waren bzw. sind.
Ich denke, die Anzahl der Menschen, die Kinder „wegen der Allgemeinheit“ bekommen haben, lässt sich an zehn Fingern abzählen.