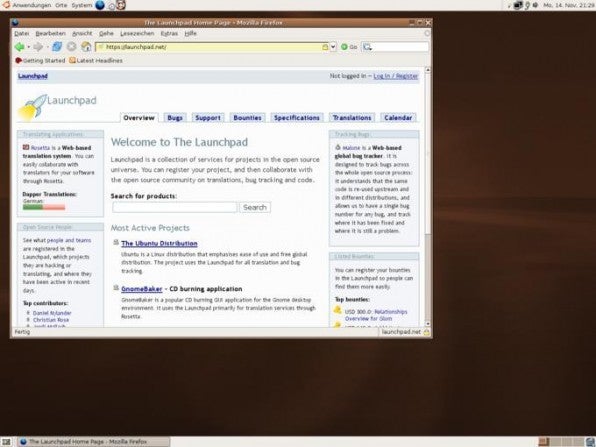Der neue Shooting-Star am Distributionshimmel: Ubuntu-Linux
Ubuntu bedeutet ungefähr soviel wie „humanity to others“ oder auch
„I am what I am because of who we all are“. Der Gründervater von Ubuntu [1] ist Mark Shuttleworth, ein südafrikanischer Multimillionär, der
durch seine ehemalige Sicherheitsfirma Thawte erfolgreich wurde. Er
stellte durch seine neu gegründete Firma Canonical [2] für die
Entwicklung von Ubuntu eine Reihe namhafter Debian-Entwickler ein. Durch
diese Einstellung ist eine konzentrierte Arbeit der Entwickler an Ubuntu
möglich.
Ubuntu setzt auf die solide Debian-Distribution auf. Die Entwickler
haben dazu Pakete aus dem Debian-Entwicklerbereich genutzt und diese
verfeinert. Außerdem konzentriert sich Ubuntu nur auf die namhaften
Hardware-Architekturen wie i386, PowerPC und die neuen
64-Bit-Prozessoren von Intel und AMD. Damit entfallen eine
Reihe
Anpassungsarbeiten, die bei Debian noch notwendig sind.
Doch warum überhaupt Ubuntu?
Das vorrangige Ziel war eine auf dem Desktop erfolgreiche
Distribution. Obwohl immer wieder gelobt und mit Hoffnung versehen, ist
freie Software dort noch nicht so erfolgreich wie sie es sein könnte.
Sie muss oftmals stärker ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen als die
meist schon vorhandende Windows-Installation. Ubuntu möchte hier
Maßstäbe setzen, indem es die Benutzbarkeit und Verwaltung des
Desktops drastisch vereinfacht. Und der Maßstab für die Benutzbarkeit
ist nicht der schon eingewöhnte Benutzer, sondern Umsteiger oder
Erstnutzer.
Die Installation
Die Installation ist sehr einfach. Alle auf Debian basierenden
Distributionen setzen heute den Debian-Installer ein, eine modular
aufgebaute Installationsroutine, die eine Anpassung an unterschiedliche
Belange erlaubt und bereits in viele Sprachen übersetzt wurde. Nach der
recht einfachen Installation werden noch einige Einstellungen nach dem ersten Neustart
vorgenommen, ein Benutzer eingerichtet und man wird vom GNOME-Desktop begrüßt. Dies ist die grafische Standard-Oberfläche von
Ubuntu.
Eine wichtige Frage taucht bei der Benutzung von Ubuntu dann
ziemlich schnell auf. Wie lautet das Passwort für den Benutzer „root“?
Die einfache Antwort dazu lautet: Der Benutzer „root“ wird
normalerweise nicht direkt genutzt. Vielmehr verwendet Ubuntu
konsequent „sudo“ (siehe
Box Sudo), ein Programm, das einem normalen Benutzer Sonderrechte
einräumen kann. Und diese Sonderrechte werden dem neu angelegten
Benutzerkonto bei der Installation automatisch zugewiesen.
Was ist eigentlich alles onboard?
Die komplette Software, die man von normaler Büro- und Internetarbeit
gewohnt ist. Als Webbrowser steht Mozilla Firefox bereit, als
E-Mail-Programm Evolution (oder auch Mozilla Thunderbird), und mit
OpenOffice 2.0 ist eine ausgereifte Office-Suite dabei. Programme zum
Betrachten oder Bearbeiten von Bildern sind ebenfalls installiert.
Multimedial stehen ein Videoplayer und, mit
Rhythmbox,
eine an iTunes angelehnte Music-Suite zur Verfügung. Das Brennen von
CDs und DVDs ist in den Datei-Explorer Nautilus direkt integriert und
somit extrem einfach benutzbar. Man denke nur an manch grauenhaft
„benutzerfreundliche“ Oberfläche der Brennprogramme unter Windows.
Die Installation weiterer Software geschieht grafisch durch
das Programm „Synaptic“ [3] in einem einfachen Modus oder in der erweiterten
Expertenvariante. Das System bleibt mit diesem Mechanismus dank automatischer Sicherheitsupdates stets aktuell.
Zudem ist seit dem „Breezy“-Release von Ubuntu (Version 5.10) ein
weiterer Bonus mit eingeflossen: Eclipse,
eine Power-Entwicklungsumgebung initiiert von IBM, ist in Ubuntu
ebenfalls eingezogen. Insgesamt stehen für Ubuntu eine vergleichsweise
hohe Anzahl an Softwarepaketen zu Verfügung. Ubuntu unterscheidet dabei
lediglich zwischen einem Bereich mit
Support und einem Bereich ohne Support, eine Tatsache, die einen
Privatanwender aber nicht besonders stört.
Noch immer nicht überzeugt?
Ergänzend sei erwähnt, dass Ubuntu halbjährlich ein neues
Release veröffentlicht. Nach dem Namensschema „Jahr.Monat“ kam im Oktober
2004 das Release 4.10 mit dem Codenamen „Warty Warthog“, im April 2005
5.04 „Hoary Hedgehog“ und erst vor kurzem folgte das dritte Release
5.10 „Breezy Badger“. „Breezy Badger“ stellt dank leistungsfähigem
Hotplug-System und Verbesserungen in der Energieverwaltung einen neuen
Meilenstein dar. Nach guter Tradition wird der Name des nächsten Releases
im Übrigen immer noch von Mark Shuttleworth persönlich veröffentlicht.
Nicht nur für den Desktop
Galt der erste Schritt von Ubuntu noch dem Desktop, entwickelte sich
schon früh die Tendenz, Ubuntu auch für den Server zu nutzen. Eine
angepasste Installationsroutine war der erste Schritt dazu. Diese vermied
einfach die Installation einer grafischen Benutzeroberfläche. Die
Ausrichtung auf eine vollständige Server-Distribution ist aber dennoch
unverkennbar. Mit dem Release „Breezy Badger“ kam erstmals eine eigene
Installations-CD für Server [4] heraus. Hervorragend geeignet, um einen
einfachen TYPO3-Server aufzubauen, sind ein Apache Server in
der Version 2, PHP in den Versionen 4 und 5 und neben MySQL
auch PostgreSQL vorinstalliert.
Die Community wächst
Ubuntu ist bereits ein integraler Bestandteil der Community geworden
und die eigene Community wächst mit jedem Release. Auf
DistroWatch.com [5] ist Ubuntu unter den wichtigsten Distributionen bereits
auf Platz 1 geklettert. Es ist schon lange nicht mehr nur
ein „Debian-Ableger“, sondern durch seine eigene Infrastruktur eine
treibende Kraft der Debian-basierten Distributionen. Mit Launchpad [6] betreibt Ubuntu eine eigene Plattform mit Services rund um die
Software-Entwicklung. Davon profitiert nicht nur
Ubuntu, sondern alle Distributionen. Nicht-Programmierer können über das
webbasierte „Rosetta“ (siehe Infobox) ihren Beitrag an
der Übersetzung von Software beitragen oder in den Foren und
Mailinglisten andere Nutzer unterstützen. Mit Malone nutzt Ubuntu ein
neues leistungsfähiges Bugtracking-System,
das nicht nur die Grenzen von Ubuntu kennt, sondern die Kommunikation
vieler Beteiligter bei der Lösung von Bugs unterstützt, auch über
Distributionsgrenzen hinaus. Und mit Bazaar wird parallel zur
Distribution ein verteiltes Versionsverwaltungssystem für Ubuntu
entwickelt.
Ubuntu ist sowohl idealistisch als auch pragmatisch. Sein Idealismus
ist eine freie und hervorragende Distribution, sein Pragmatismus,
die richtigen Werkzeuge für die Entwicklung einzusetzen und eine
einfach zu benutzende Distribution zu
sein. Darüber hinaus hat die rege Entwicklung mittlerweile neue
Projekte wie „Kubuntu“ (Ubuntu mit KDE-Desktop) und „Edubuntu“ (Ubuntu
für den Bildungssektor) ins Leben gerufen.
Und wie gehts weiter?
Zur finanziellen Sicherung des Projekts hat
Mark Shuttleworth am ersten Juli 2005 die Ubuntu Foundation gegründet
und
sie mit einem Budget von zehn Millionen US-Dollar ausgestattet.
Gesichert scheint die Zukunft auch durch die Akzeptanz seitens
IT-Konzernen wie HP oder
IBM. HP veröffentlichte kürzlich Pläne zur direkten Unterstützung von
Ubuntu auf
seinen Notebooks. IBM bescheinigte der Server-Variante von Ubuntu die
Tauglichkeit für den Unternehmenseinsatz und zertifizierte Ubuntu als
„Ready for DB2“ – den hauseigenen Datenbank-Server. Und mit dem neu
entstehenden Partnernetzwerk [7] werden von einer Vielzahl
qualifizierter Firmen Zusatzleistungen auf hohem Niveau angeboten.
Ausblick
Das neue Release „Dapper Drake“ wird im April 2006 wohl zeitgleich mit
Microsofts „Vista“ erscheinen. Das Ubuntu-Projekt sieht nicht zuletzt
deshalb die Herausforderung
für das nächste Release darin, seinen Anwendern eine hochwertige
Betriebssystem-Alternative zu bieten. Dazu wird es erstmals drei Jahre
Support für den Desktop und fünf Jahre
Support für den Server geben. Man darf also mit Spannung dem Jahr 2006
entgegensehen.
| Ubuntu ShipIt |
| Ein tolles Programm zur Verbreitung von Ubuntu ist ShipIt. Es besteht dabei die Möglichkeit sich kostenlos Ubuntu-CDs zusenden zu lassen. Selbst die Kosten für das Porto werden übernommen. Dies ist eine attraktive Idee um den Bekanntheitsgrad von Ubuntu zu steigern. Bestellen Sie sich also ruhig ein paar CDs und verteilen Sie diese unter Ihren Freunden und Bekannten. https://shipit.ubuntu.com/ |
| Rosetta |
| Internationalisierte Software funktioniert heute fast immer mit dem Gettext System. Dabei werden die zu übersetzenden
Zeichenketten aus dem Quellcode der Software ausgelesen und in einer eigenen Datei gespeichert. Diese Zeichenketten können nun von Übersetzern in die jeweilige Landessprache übersetzt werden. Die lokalisierte Software sucht beim Starten der Anwendung nach den Spracheinstellungen in den Umgebungsvariablen und bindet die richtige Übersetzung ein. Um den Anreiz für Nichtprogrammierer zu erhöhen, können nun Übersetzer auf Launchpad.net auch webbasiert mitarbeiten. |
| Sudo |
| Ein kleiner Mechanismus, große Wirkung. Viele Benutzer arbeiten aus Bequemlichkeit mit administrativen Benutzerkonten um
"nicht ständig wechseln zu müssen". Dieses Verhalten ist mit sudo nicht mehr notwendig. Sind administrative Aufgaben fällig, so sorgt ein Programmaufruf mit vorangestelltem sudo nach Angabe des eigenen Passworts für die notwendigen Rechte. |