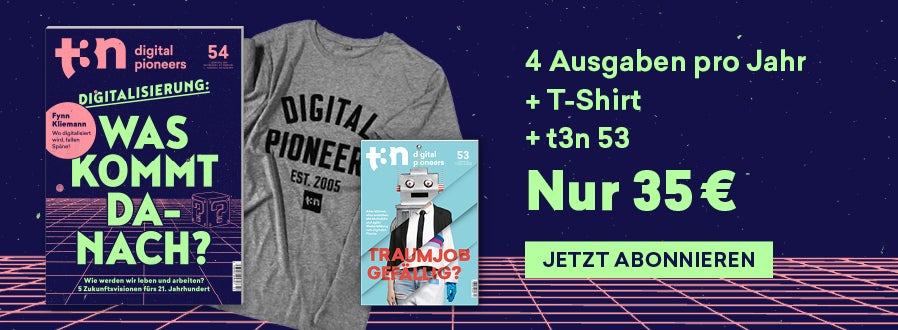Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war

Klaus Bürgle: Die erste Marskolonie, 1976. (Illustration: Klaus Bürgle, Foto: Horst Alexy)
Ralf Bülow, ein Mann in seinen Sechzigern, im grünen Pullover, einem braunen Cordjackett und silberner Brille, steht, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, vor der Versuchslok „202 003-0“. Die Lok ist fugenlos rund wie ein U-Boot auf Schienen, Scheinwerfer und Windschutzscheibe sind in die Rundung eingelassen. Mit dem weiß-blauen Streifen sieht die Lok so aus, als wehten ihr auch im Stand noch 350 Kilometer pro Stunde Wind um die Nase. „Die ist aus der Zeit, in der Zukunft noch was war“, sagt Bülow und seufzt.
Der Mathematiker ist Mitglied der Forschergruppe „Die Zukunft in den Sternen: Europäischer Astrofuturismus und außerirdisches Leben im 20. Jahrhundert“ an der FU Berlin und begeistert sich schon ein Leben lang für die Zukunft: „Angefangen hat das mit dem Jahrbuch Das Neue Universum, da gab es Faltbilder von Raumstationen und futuristischen Bahnhöfen“, erzählt er. Fünfzig Jahre ist das her. „Heute ist es ja schon eine gewagte Vision, einen Flughafen in Berlin fertigzustellen.“ Ralf Bülow ist der Zukunft der 1960er, der Zukunft aus den Bildern in „Das Neue Universum“ treu geblieben. Auch wenn die tatsächliche Zukunft sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Während in der richtigen Welt Computerchips und das Internet ihren Siegeszug angetreten haben, hat Bülow angefangen, die alten futuristischen Zeichnungen von Klaus Bürgle zu sammeln. Im Laufe der Jahre wurde aus dem Futuristen Bülow ein Retro-Futurist. Irgendwann hat ihn ein Museum gefragt, ob er seine Sammlung nicht für eine Ausstellung zur Verfügung stellen wolle. „Smartphones“, sagt er und schaut mich an, während ich mit dem Handy ein Bild von der Lok mache. „Das kann es ja noch nicht gewesen sein, mit der Zukunft.“
Gerade jetzt, Stand Herbst 2018, ist die Zukunft wieder sehr nah, sehr greifbar. Wie zu der Zeit, als der junge Ralf Bülow noch Bilder von Weltraumbahnhöfen in Das Neue Universum betrachtete. Elon Musk arbeitet daran, Touristen ins All zu schießen – sein Tesla ist da ja schon unterwegs. Yuval Noah Harari, der Bestsellerprophet der Stunde, sieht Designerbabys und eine Datenreligion am Horizont. Etliche Vordenker und Wissenschaftler der Tech-Elite warnen vor einer Machtübernahme durch künstliche Intelligenz. Ray Kurzweil, der Erfinder des Flachbett-Scanners und heute als Chefingenieur bei Google tätig, Nick Bostrom, Zukunftsforscher in Oxford, und Ben Goertzel, der Chefwissenschaftler des Roboterbauers Hanson Robotics, gehen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Maschinen uns in Sachen Intelligenz den Rang ablaufen.
Doch was folgt auf den Hype um das Thema Zukunft – ist es wirklich die Zukunft oder doch eher die Enttäuschung? Welche Zukunft landet im Museum und welche Zukunft haben wir irgendwann ganz selbstverständlich in der Tasche? Können wir das jetzt schon abschätzen? Oder anders gefragt: Wer kann das schon abschätzen? Die Jeff Bezos’, Mark Zuckerbergs und Ray Kurzweils dieser Welt? Zukunftswissenschaftler? Historiker? Wie gut hat das eigentlich bisher geklappt, die Zukunft vorherzusagen? Ich habe mich auf die Suche gemacht, um die Hürden und Grenzen der Zukunftsforschung auszuloten: gemeinsam mit Historikern, Zukunftsforschern, Skeptikern und Startups, die der Zukunft mit Märkten und mithilfe der Crowd näherkommen wollen.
Der Post-Apollo-Komplex
„Grüße aus der Stadt der Zukunft“, schreibt mir Alexander Geppert in einer E-Mail. Bevor er für die New York University nach Shanghai ging, leitete er in Berlin die Forschungsgruppe „Die Zukunft in den Sternen“, bei der auch Ralf Bülow Mitglied ist: ein Forschungsprojekt zur Geschichte des „Space Age“, der goldenen Zeit der Zukunft und Raumfahrt in den 1960ern. Geppert skypt von zu Hause aus und trägt dabei ein weißes T-Shirt, nach hinten geschwungene, dunkle Haare, und einen Zwei-Tage-Bart.
Aus Gepperts Perspektive fand der Zukunfts-Hype des vergangenen Jahrhunderts mit seinem Höhepunkt in den 60ern vor allem im Weltraum statt. „Einer der ersten Filme überhaupt war 1902 ‚Die Reise zum Mond‘ von Georges Méliès“, erzählt Geppert. „Seit den 1950er-Jahren wurde der Weltraum mit vielen Filmen immer bunter, besiedelter und konkreter vorgestellt, lange bevor der erste künstliche Satellit überhaupt im Erdorbit stationiert wurde. Die Ideen von Weltraum und Zukunftsszenarien befeuerten sich gegenseitig. Von den 1940ern bis in die 1970er ging man fest davon aus, dass die Zukunft im Weltraum stattfinden müsse und werde“, sagt Geppert. Und dann? „Und dann nichts. Ich nenne das das Post-Apollo-Paradox. Schon kurz nach der Mondlandung spielte der Weltraum eine viel weniger zentrale Rolle im Nachdenken über die Zukunft.“

Hyperloop gefällig? Eine ähnliche Vision hat Klaus Bürgle bereits im Jahr 1967 gezeichnet und pragmatisch „Personenrohrpost“ genannt. Die Idee: Während ferngesteuerte Hochbahnzüge oberirdisch den Schnellverkehr übernehmen, sollen die rund drei Meter dicken Fahrrohre unter der Erde die Menschen zwischen verschiedenen Ballungsgebieten miteinander verbinden. (Illustration: Klaus Bürgle)
Es spreche viel für die These, dass das wichtigste historische Resultat der Raumfahrt nicht der technische Sprung selbst war, sondern der Blick zurück, vom Mond auf die Erde, den er ermöglichte. Und damit ein neues Denken von der Erde als planetarischer Einheit. Nach Apollo 11 dominierten Bilder vom blauen Planeten, dem Raumschiff Erde und globalen Gefahren. Und das sei eben das Paradox: „Das Weltraumzeitalter wurde genau in dem Moment als überholt begriffen, als es globalhistorisch größere Wirkung zu zeigen begann als je zuvor.“ Die Zukunft wurde rückwärtsgewandter, introspektiver und auch ängstlicher. Man glaubte nicht mehr an Planbarkeit und Machbarkeit. Plötzlich brach sich eine Einsicht Bahn: Wenn die Menschheit so weiter macht, richtet sie den Planeten zugrunde. Zukunftsvisionen und Weltraumvisionen brachen dabei auseinander. „Aus historischer Perspektive war das Space-Age Anfang der 1970er-Jahre vorbei.“
Erstaunlich ist, dass sich vor allem viele Historiker mit der Zukunft beschäftigen. Ich verabrede mich mit Elke Seefried in der Nähe des Potsdamer Platzes. Seefried ist stellvertretende Direktorin des Instituts für Zeitgeschichte in München und hat ein Buch über die Geschichte der Zukunftsforschung geschrieben. Sie hat sich an eines der großen Fenster des Cafés gesetzt und schaut hinaus auf den Platz mit Brunnen, auf dem jetzt, im Herbst, die Blätter umherwehen.
Nachdem Alexander Geppert vom Zukunftsboom der 1960er erzählt hat, will ich von ihr wissen, ob sich zwischen der damaligen Technologie-Euphorie und heute Vergleiche ziehen lassen: „Geschichte wiederholt sich nicht“, erklärt Seefried. „Aber ich sehe in der Tat erstaunliche Ähnlichkeiten zu den 60ern, in denen es auch einen Technologie-Boom mit Technik- und Wissenschaftsbegeisterung gab. Damals dachte man, die Atomtechnologie würde unbegrenzte, saubere Energie liefern. Das erinnert mich an die aktuelle Stimmung und die Erwartungen an künstliche Intelligenz. Übrigens dachte man auch damals, man könne mit Computersimulationen die Folgen bestimmter Entscheidungen durchspielen und entsprechend reagieren. Das hat nicht geklappt. In der Zukunftswissenschaft ist das als Lernprozess reflektiert, in der Öffentlichkeit eher weniger.“
Dass sich so viele Historiker wie Geppert und Seefried mit der Zukunft beschäftigen, ist natürlich kein Zufall. Auf den zweiten Blick sind das Konzept Vergangenheit und das Konzept Zukunft nämlich nicht gegensätzlich, sondern haben erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. Dass im Jetzt die Vergangenheit und die Zukunft gerade beide nicht da sind, liegt in der Natur der Sache. Beide kann ich mir nur vorstellen: Wenn etwa die Zeit gekommen ist, Zukunft zu erleben, ist sie ja schon wieder Gegenwart. Die Gemeinsamkeiten von Vergangenheit und Zukunft sind allerdings nicht rein philosophischer Natur. Beides entsteht auch biologisch am selben Ort: Einem Teil des Gehirns, der sich Hippocampus nennt.
„Unser Gedächtnis ist kein Video, das man abspielen kann. Stattdessen ist es ein rekonstruktiver Prozess, bei dem wir Lücken mit unserem Wissen über die Welt ausfüllen“, erklärt mir Roland Benoit, Neurowissenschaftler und Leiter einer Forschungsgruppe zum Thema Erinnerung am Max-Planck-Institut, am Telefon. Dieser rekonstruktive Prozess des Erinnerns, sagt er, mache eine Menge Probleme. Zum Beispiel, wenn wir als Augenzeugen etwas beschreiben sollen, was in der Vergangenheit liegt. Der Vorteil davon ist aber, dass wir mit ihm auch die Zukunft simulieren können. Zukunftsvorstellungen, erklärt Benoit, beruhen darauf, verschiedene Inhalte, die vom Gedächtnissystem bereitgestellt werden, neu zusammenzufassen: „Stellen Sie sich vor, Sie wollen zum ersten Mal einen Berg im Himalaya besteigen. Sie wissen nicht, wie das wird, können es sich aber vorstellen. Dazu nehmen Sie dann vielleicht Erinnerungen aus den Alpen, Bilder aus dem Fernsehen oder Geschichten vom Hörensagen. Die Erinnerung hilft Ihnen auch, zu planen. Sie erinnern sich, dass Sie zum Beispiel durstig sind, wenn sie bergsteigen, und nehmen eine Flasche Wasser mit. Dank der Erinnerung können sie schon vorher fühlen, wie es sein wird, wenn Sie in der speziellen Situation sind.“ Und wie gut funktioniert diese Erinnerungstechnik für generelle Technologieprognosen? „Technische Entwicklungen, für die wir keinen Ansatz haben, können wir uns schlecht vorstellen. In Zukunftsvisionen von vor 50 Jahren spielten Computer jedenfalls keine Rolle“, sagt Benoit.
Unsere Ideen von Zukunft sind also nur neu arrangierte Erinnerungen: Kein Wunder, dass sie deutlichen Limitierungen unterworfen sind. Und noch etwas ist mir nach dem Gespräch mit Benoit klarer als vorher: Der vielleicht wichtigste Faktor, wenn es um die Zukunftsbetrachtung – und ihre Grenzen – geht, ist die Person des Betrachters selbst: ihre Haltung, ihre Vorgeschichte, ihre Erwartungen.
Der Faktor Mensch
An der Freien Universität im Berliner Stadtteil Dahlem nimmt Gerd de Haan bei seiner Zukunftsforschung den Menschen ins Visier. De Haan leitet das Institut Futur und ist so ziemlich das Gegenteil von Internetpropheten wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg: Bei offiziellen Anlässen trägt er gern eine bunt gemusterte, akademische Fliege. Ein Bild auf den Seiten der Universität zeigt ihn mit einem Bundesverdienstkreuz am Revers. Beim Interview trägt de Haan einen orangefarbenen Strickpullover, seine silbrig-grauen Haare sind nach hinten gekämmt. Aus dem Fenster seines Büros sieht man den etwas verwildert wirkenden Garten der Villa.
De Haans Zukunftsforschung funktioniert anders als die grellen Ideen und die Machbarkeitsfantasien des Silicon Valley. De Haan geht es auch weniger darum, was machbar wird, sondern mehr darum, was tatsächlich geschieht: „Wir kümmern uns nicht nur um die Kosten-Nutzen-Frage, sondern um die emotionalen Hintergründe, warum Menschen etwas akzeptieren oder nicht akzeptieren“, sagt er mit rauchiger Stimme.
Wenn man de Haan nach den Prognosen eines Ray Kurzweil fragt, lächelt er. „Lassen Sie es mich so sagen: Solide ist das nicht. Zukunftswissenschaft ist nichts, was sagt: So wird das werden. Wir sprechen eher von Zukünften, möglichen Szenarien.“ Einige Entwicklungen wie zum Beispiel der Klimawandel, so de Haan, seien recht gut zu prognostizieren, weil sie auf physikalischen Gesetzen beruhen: Eine bestimmte Menge CO2 sorgt für eine bestimmte Erderwärmung. „Prognosen sind nichts anderes als eine Prolongierung der Gegenwart, die wir haben. Prognosen gehen von einer bestimmten Form von Stetigkeit aus. Aber in gesellschaftswissenschaftlichen Fragen ist es schwierig, eine Stetigkeit anzunehmen.“
Wenn man De Haan nach dem aktuellen Hype um Zukunft fragt, nach der Euphorie, malt er eine Kurve auf ein Blatt Papier, die erst steil ansteigt, dann steil abfällt und dann langsam in einem sanfteren Bogen wieder ansteigt. Ein sogenannter Hype-Zyklus, mit dem auch die Tech-Forschungs- und Beratungsfirma Gartner arbeitet. De Haan interessiert sich dabei vor allem für Knickpunkte. Momente, an denen die Gesellschaft von so einer Euphorie wieder herunterkommt. Im Silicon Valley, wende ich ein, glaubt die Tech-Elite, dass die Menschheit gerade vor einer Art technischem Urknall stehe, weil alle möglichen Entwicklungen zusammenkämen. „Man macht die Rechnung dort oft ohne den Menschen“, erklärt de Haan. „Da ist zu wenig bedacht, dass das Interesse an Eigenständigkeit, Eigentätigkeit und Eigenwilligkeit stark verankert ist. Dass man sich der ganzen Sache eventuell bedient, aber es dann vielleicht auch wieder lässt. Alles an die große Maschine delegieren, die uns selbst dann auch noch einspannt, entspricht nicht unserer Vorstellung von Autonomie“, sagt er. Sein Punkt: Bei Zukunft geht es weniger darum, was technisch möglich ist, als darum, was Menschen langfristig gut finden. Technisch gesehen kann man immer mehr Kommunikation und Interaktion über das Internet abwickeln. Ob wir das wirklich wollen, ist aber eine andere Frage.

Hyperloop gefällig? Eine ähnliche Vision hat Klaus Bürgle bereits im Jahr 1967 gezeichnet und pragmatisch „Personenrohrpost“ genannt. Die Idee: Während ferngesteuerte Hochbahnzüge oberirdisch den Schnellverkehr übernehmen, sollen die rund drei Meter dicken Fahrrohre unter der Erde die Menschen zwischen verschiedenen Ballungsgebieten miteinander verbinden. (Illustration: Klaus Bürgle)
Vor allem Wirtschaftswissenschaftler haben sich in den letzten Jahren mit der Frage beschäftigt, wie komplex und schwierig Prognosen werden, wenn Menschen dabei eine Rolle spielen. Von all den Prognosekritikern treibt Nassim Nicholas Taleb es gewissermaßen auf die Spitze. Der Statistiker, ehemalige Wall-Street-Trader und Hedgefonds-Manager, hat für das Unerwartete und Unprognostizierbare den Begriff Black-Swan-Event geprägt. Mit dem Titel Schwarzer Schwan bezieht sich Taleb auf ein altes Sprichwort, demzufolge schwarze Schwäne nicht existieren. Ein Sprichwort, dass, so Taleb, umgedeutet wurde, nachdem man wild lebende schwarze Schwäne entdeckte. Taleb will damit auf Ereignisse hinweisen, die selten sind, überraschend kommen, den Verlauf der Geschichte aber überproportional stark beeinflussen. Inspiriert, so Taleb, habe ihn dabei der Börsencrash vom sogenannten Schwarzen Montag im Jahr 1987. „Trotz der empirischen Daten planen wir für die Zukunft, als ob wir gut darin wären“, schreibt er in seinem Buch. Menschen, so Taleb, neigten dazu, den Einfluss von rein zufälligen Ereignissen zu unterschätzen und den Grad der Planbarkeit der Zukunft zu überschätzen. In Sachen Zukunft glaubt Taleb nicht an die Gaußsche Normalverteilung und Dinge, die wahrscheinlich passieren. Unternehmen rät er daher zu finanzieller Robustheit, um sich auf das Unerwartete vorzubereiten und nicht vom nächsten Schwarzen Schwan kalt erwischt zu werden. Taleb veröffentlichte sein Buch im April 2007. Drei Monate später begann die Finanzkrise. Spätestens die Pleite von Lehman Brothers gab Taleb in Fragen von Erwartbarkeit des Unerwarteten auf spektakuläre Art Recht.
Der Politikwissenschaftler Philip Tetlock von der Universität Pennsylvania hingegen hat gewissermaßen einen Sport daraus gemacht, Expertenpognosen auf den Prüfstand zu stellen: Nachdem er zwischen 1984 und 2003 einen wissenschaftlichen Vorhersagewettkampf mit 284 Politikexperten und rund 28.000 Prognosen ausgewertet hatte, schlussfolgerte er, der durchschnittliche Experte sei ungefähr so treffsicher wie ein Dart spielender Schimpanse. Mit anderen Worten: Nicht besser als der Zufall. Je größer die Medienöffentlichkeit eines Experten, umso schlechter schnitt er bei dem Experiment übrigens ab.
„Zukunftswissenschaft ist nichts, was sagt: So wird das werden.“
Bei Tetlocks späteren Experimenten kristallisierte sich aber auch eine andere Gruppe heraus, die wesentlich erfolgreichere Prognosen stellt. Diese Super-Forecaster, wie er sie nennt, haben unterschiedlichste Jobs – mal Fabrikarbeiter, mal Matheprofessorin, mal arbeitslos. Nur mit einem Computer und dem Internet ausgestattet, kamen sie aber auf signifikant bessere Ergebnisse als die meisten Experten. Trotz unterschiedlichster Hintergründe haben Tetlocks Super-Forecaster ein paar Gemeinsamkeiten: Sie stützen sich selten auf nur eine oder zwei große Ideen, um die Welt zu erklären, sondern gehen von einem hohen Grad an Komplexität aus. Sie sind auch nicht in erster Linie daran interessiert, ob ihre Vorhersagen richtig oder falsch sind, sondern, wie sie besser werden können. Aus all dem leitet Tetlock die Forderung ab, die Glaubwürdigkeit eines Orakels weniger nach Ruhm, Macht oder wissenschaftlichen Titeln zu beurteilen, sondern nüchtern an den Prognoseerfolgen der Vergangenheit. Einen Super-Forecaster erkenne man nicht am Professorentitel oder den Milliarden auf dem Konto, sondern an vielen guten Prognosen.
Die Kraft der Crowd
An der Skalitzer Straße in Kreuzberg, im Backsteingebäude der alten Post, sitzt Martin Köppelmann an einem langen Tisch im Coworking-Space Full Node. Köppelmann trägt ein Hemd unter einem dunklen Sweater und einen Fünf-Tage-Bart. Er und sein Blockchain-Startup Gnosis haben schon einmal ziemlich viel Glück mit der Zukunft gehabt. Anfang 2017 kamen bei ihrem ICO in ein paar Minuten 250.000 Ether zusammen. Zu den Hochzeiten der Währung waren das über 200 Millionen US-Dollar. Jetzt arbeitet er mit Gnosis an einem Projekt, das gewissermaßen Technologie, Experten, Schwarmintelligenz und Super-Forecaster auf einen Nenner bringt. Auf jeweils eine Zahl, um genau zu sein.
Die zentrale Idee von Gnosis ist es, einen Markt für Zukunftsprognosen zu schaffen. Prediction Markets nennt Martin Köppelmann das, und das Modell erinnert ein bisschen an die Buchmacher in London, bei denen man auch auf alle möglichen Ereignisse wetten kann: den Ausgang von Wahlen, das Wetter, Sport, oder, welcher Politiker wie lange im Amt bleibt. Vor vielen Ereignissen gelten die Quoten als die zuverlässigsten Einschätzungen. Der Unterschied zwischen Gnosis und den Buchmachern ist aber, dass bei den Buchmachern die Quoten von Experten und Statistikern gemacht werden. Bei den Prediction Markets von Gnosis sind es die Quoten selbst, die gehandelt werden – und die Crowd bestimmt den Preis.
„Nehmen wir mal den Berliner Flughafen. Wann fliegt da endlich ein Flieger?“, fragt Martin Köppelmann. „Oder anders: Wird er noch vor 2021 eröffnet werden? Aus dieser Frage kann man ein Finanzprodukt, eine Wette, erzeugen. Das Produkt zahlt einen Dollar aus, wenn er vor 2021 eröffnet wird und es zahlt nichts aus, wenn es nicht passiert. Auf diese Option – Öffnung vor 2021 – können Anleger also wetten. Mit Gnosis schaffen wir einen Marktplatz, auf dem man die Option selbst kaufen oder verkaufen kann.“ Die Theorie funktioniert folgendermaßen: Wenn die Option bei 60 Cent gehandelt wird, denkt der Markt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Flughafen vor 2021 eröffnet wird, beträgt 60 Prozent. Wenn ein Experte aber denkt, die Wahrscheinlichkeit sei höher als 60 Prozent, zum Beispiel 70 Prozent, hat er ja ein Interesse daran, die Option zu kaufen: Für nur 60 Cent bekommt er eine Option, die in seinen Augen 70 Cent wert ist. „Als Experte kaufe ich das Ding also, erhöhe die Nachfrage und damit den Preis. Wir haben einen neuen Marktpreis. Und jeder, der denkt, er weiß es besser, hat einen direkten Anreiz zu traden.“
Was Köppelmann daran gefällt ist, dass man nicht vorher festlegen muss, wer zu welchem Thema ein Experte ist. „Wer formal als Experte identifiziert wird, ist nicht notwendigerweise der, der es am besten weiß“, sagt er. Dem Expertenkritiker Tetlock würde das bestimmt gefallen. „Banal gesagt, ist es qualitativ ein Unterschied, ob jemand sagt ‚Ich bin mir sicher‘, oder ob jemand 10.000 Euro darauf setzt“, so Köppelmann. Die Prediction Markets klingen nach Wahrscheinlichkeiten für nahe Zukunft statt nach großen Visionen. Ein Geschäftsmodell, das es so ähnlich schon gibt, das aber auf Blockchain-Basis weitergedacht wurde. Etwas unspektakulärer als laufende Roboter und Weltraumbahnhöfe. Nichts, was man anfassen oder damit herumfliegen könnte. Nichts, was man schön in ein Museum stellt . Wahrscheinlich auch nichts, wofür sich der Zukunftsnostalgiker Ralf Bülow begeistern würde. Aber vielleicht ist das genau der Punkt.
Vielleicht sollten wir einfach in zwei verschiedene Kategorien von Zukunft unterscheiden: Die Realo-Zukunft und die Phantasto-Zukunft. Realo-Zukunft wäre dann die mit den Wahrscheinlichkeiten und Prognosen. Die Zukunft, die sich mit kleinen Veränderungen einschleicht, bei der Leute weiterhin mit Aktentaschen in Büros gehen, und die dabei als neues Datenverarbeitungswerkzeug im Hintergrund läuft. Realo-Zukunft ist weder schön noch hässlich, sondern einfach nur wahrscheinlich und vielleicht schon da. Die Zukunft hingegen, von der Ralf Bülow träumt, wäre dann die Phantasto-Zukunft. Eine Fantasie, die man vorausdatiert, so wie man die Ritter der Tafelrunde eben zurückdatiert. Sie wäre vor allem auch Fantasie, die mal mehr in Mode ist, mal weniger. Das goldene Space-Age in den 1960er-Jahren oder die fantastischen Vorhersagen einer Superintelligenz von heute. Die Menschen begeistert, aber unter Umständen enttäuscht in der Realität zurücklässt. So wie Ralf Bülow.