Die Kunst des Hinschmeißens: Warum es manchmal das Beste ist, aufzugeben
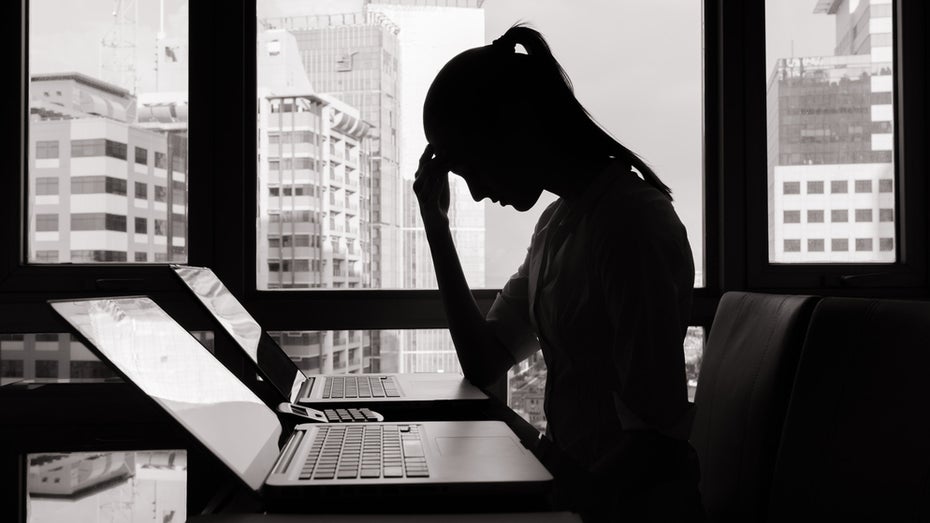
Keine Entscheidung ist meist eine schlechte Entscheidung und schlechte Entscheidungen sind menschlich. (Foto: Shutterstock)
Du hättest früher kündigen sollen. Du hättest das Projekt früher einstampfen sollen. Du hättest früher um Unterstützung bitten sollen. Du hättest früher umziehen sollen. Du hättest dich früher trennen sollen. Du hättest dem Kunden früher sagen sollen, wohin er sich – nun ja. Also, wie oft hast du jetzt genickt? Ich nicke beim Schreiben die ganze Zeit, weil sich jede dieser nicht getroffenen Entscheidungen in meine Biographie einfügt.
Ich wage zu behaupten: Es geht den meisten Menschen so. Und in vielen Situationen hat die Verzögerung uns (mich, dich, irgendwen) krank gemacht. Erschöpfung, weil der Job nicht passt und der Chef zurück in die Hölle gehört, in der er sein Sozialverhalten gelernt hat. Wut und Traurigkeit in Beziehungen, die sich überlebt haben. Zweifel, vielleicht Ängste und Sorgen bei Projekten. Und die ganze Zeit über habe ich mich selbst ein wenig gehasst, weil ich nicht entschieden habe, was entschieden werden musste. Selbstachtung ade.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin überwiegend im Reinen mit meinen Lebensentscheidungen und ich hoffe, es geht dir ähnlich. Es gibt Gründe, warum ich manchmal zu spät entschieden habe, und du hast die Deinen. Die Trias der Entscheidungsverweigerung: nicht getraut, nicht bereit und der Glaube an das Gute.
Keine Entscheidung ist meist eine schlechte Entscheidung und schlechte Entscheidungen sind menschlich. Rational ist das alles nicht. Das muss es nicht sein. Besser geht es trotzdem.
Wer kämpft, schiebt die Niederlage auf
„Wenigstens hast du es durchgezogen“, so klingt ein leicht-fatalistisches aber gut gemeintes Lob. Artverwandt zu: „Du hast gut gekämpft.“ Aber vielleicht sollten wir umdenken: „Wenigstens hast du rechtzeitig kapituliert“, könnte der smartere Ansatz sein. Denn wer nicht aufgibt, könnte damit Ressourcen verschwenden, obwohl längst klar ist, dass ein Projekt keine Erfolgsaussichten mehr hat. Eine mögliche Antwort: Gib auf, wenn du zum ersten Mal darüber nachdenkst, ob du aufgeben solltest. So hart schreibt es Poker-Ikone Annie Duke in ihrem Buch „Quit“ (Ariston Verlag).
Wer zweifelt, schiebt das vielleicht auf innere Unsicherheiten. Statt den Fehler im Projekt zu suchen, suchen Menschen bei sich selbst. Sie wären gern stärker und übersehen dabei, dass ihr Urteilsvermögen um Aufmerksamkeit bettelt.
Wir nennen es Bauchgefühl und behaupten, es sei irrational. Aber Bauchgefühl ist ein Produkt unserer Erfahrungen, das sich immer dann meldet, wenn wir Ideale, Standing oder den Glauben an das, was sein soll über unseren Verstand stellen. Auf Dauer wird das Bauchgefühl zum Magengeschwür.
Die Angst ist unbegründet – sagt die Statistik
Veränderung macht Menschen glücklich. Das hat erst einmal neurologische Gründe: Brechen wir aus dem Gewohnten aus, dann muss das Gehirn arbeiten. Ein neuer Arbeitsweg muss entdeckt und gespeichert werden. Eine neue Wohnung muss sich einprägen. Ein neuer Job – trotz all seiner Unbekannten! – inspiriert Menschen. Ein neues Team ist eine Gelegenheit, die eigene Arbeitspersönlichkeit zu justieren. Du bist eine Chance für sie, sie sind eine Chance für dich.
Und dann gibt es da noch die Studie zur Veränderung. Ein Team von Forschenden hat Menschen befragt, welche Entscheidungen sie gerade plagen und wie es um ihre Lebenszufriedenheit stand. Später haben sie nachgefragt. Jene, die sich für die Veränderung entschieden hatten, waren in der Regel glücklicher. Selbst eine Münze zu werfen ist klüger, als nichts zu tun. Kopf: Kampf. Zahl: Flucht.
Erstens gibt es eine gewisse Chance, dass der Zufall schlauer ist als du. Zweitens aktiviert das Ergebnis hoffentlich dein Urteilsvermögen. Es gefällt dir nicht? Da hast du deine Antwort. Der Ökonom Steven Levitt sagt, dass Menschen oft zu vorsichtig sind – und das ein Münzwurf sie glücklicher machen kann.
The how to of Hinschmeißen
Als Jugendliche haben wir gelernt, eine Pro- und Contraliste aufzustellen. Doch sie ist nicht mehr als der Versuch, ein komplexes, oft dynamisches Problem auf zwei Dimensionen zu reduzieren. Das Ergebnis mag sauber aussehen – ist aber lebensfern.
Annie Duke hat einer Leserin vorgeschlagen, sich mental in die Zukunft zu versetzen. Sie fragte: „Wenn es ein Jahr später ist und Sie die neue Stelle angetreten haben (…), wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie unglücklich sein werden?“
„Ich weiß es nicht“, antwortete die Leserin.
„100 Prozent?“, fragte Duke.
„Definitiv nicht“, sagte die Leserin. Und erkannte: Aber wenn sie in dem Job blieb, der sie jetzt schon unglücklich machte, dann würde sie unglücklich bleiben. Die Veränderung war wenigstens eine Chance.
Veränderung ist außerdem die stärkste Fähigkeit der jungen Generation und die Wissenschaft ist auf ihrer Seite. Wir älteren leiden am „Status quo Bias“, wie es die Ökonomen Richard Zeckhauser und William Samuelson einst formuliert haben. „Better the devil you know“, hat Kylie Minogue gesungen. Anders gesagt: Wer weiß, ob es woanders nicht noch schlimmer ist.
Jüngere Arbeitnehmende halten mehr aus und sie fürchten einen unerträglichen Stillstand mehr als die Unsicherheit der Veränderung. Schlau von ihnen. Es lässt sie klügere Entscheidungen treffen.









