Keine Brandgefahr und doppelte Kapazität: Forscher bauen Lithium-Ionen-Akkus ohne Flüssigkeit

Lithium-Ionen-Akkus sind leistungsfähig, aber verhältnismäßig leicht entflammbar. Zudem gelten sie als kaum noch zu verbessern. Der Fokus der Batterieentwicklung liegt daher schwerpunktmäßig auf der Feststoff-Zelle.
Lithium-Ionen-Akkus mit Polymer als festem Elektrolyt
Dabei werden die Flüssigkeiten durch Feststoff-Elektrolyte ersetzt, die höhere Spannungen und Betriebstemperaturen aushalten. Entsprechende Batterien lassen sich daher schneller laden und stärker beanspruchen. Zudem speichern sie mehr Energie pro Gewichtseinheit.
Forscher der australischen Deakin-Universität haben nun ein Verfahren vorgestellt, das die Vorteile der Lithium-Ionen-Batterie mit einem Festkörper kombiniert. Anstelle der bisher üblichen Flüssigkeit als Elektrolyt setzten sie erfolgreich handelsübliche Polymere in gleicher Funktion ein und konnten den Transport der Lithium-Ionen nachweisen. Das „feste Elektrolyt“ lässt sich dabei nach Angaben der Forscher unproblematisch im industriellen Maßstab herstellen, weil dafür lediglich Polymere, die schon bisher in großem Umfang verfügbar sind, zum Einsatz kommen.
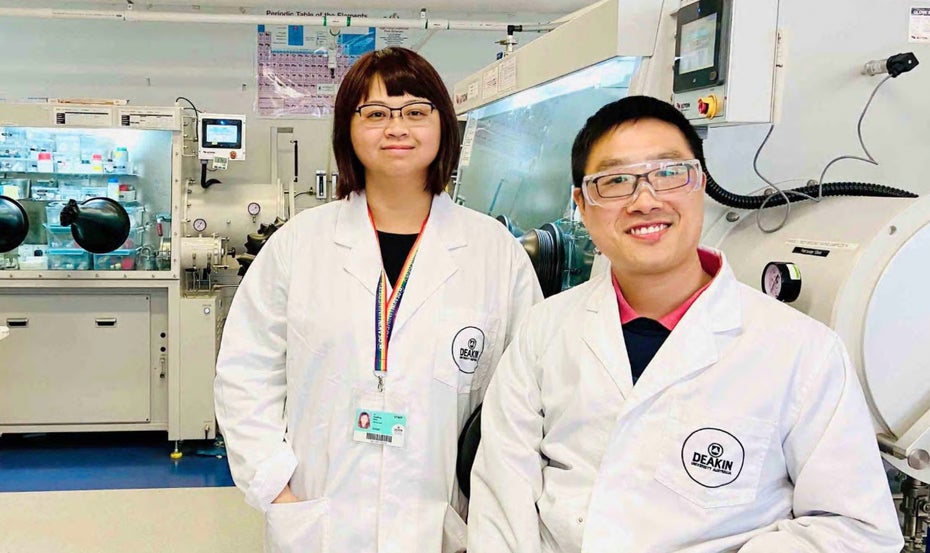
Fangfang Chen und Xiaoen Wang von der Deakin-Universiät bezeichnen ihre Forschungsergebnisse als „Durchbruch“. (Foto: Deakin University)
Festkörper-Akkus speichern die doppelte Energiemenge
Neben der Tatsache, dass Festkörper-Lithium-Ionen-Akkus nicht brennbar sind und damit eines der gefühlt größten Risiken im Umgang mit moderner Batterie-Technik beseitigen würde, können die von der Forschergruppe um Fangfang Chen und Xiaoen Wang entwickelten Feststoff-Batterien doppelt soviel Energie pro Gewichtseinheit speichern.
Damit könnte etwa eine bisher 250 Wattstunden pro Kilogramm haltende Batterie wie jene des Tesla Model 3 bei gleichem Volumen künftig 500 Wattstunden pro Kilogramm halten. Damit würde sich die Reichweite verdoppeln lassen, ohne dass es größerer Batterien und dadurch bedingter Konstruktionsänderungen bedürfte. Ebenso würden sich manche Zusatzkonstruktionen wie feuerfeste Einhausungen oder Temperatursteuerungen einsparen lassen können.
In Smartphones könnte der Kapazitätsvorteil auch genutzt werden, um die Akkus um die Hälfte zu verkleinern, ohne die bisherige Ausdauer zu schmälern.
Derzeit ist die Technik noch nicht serienreif. Bislang funktioniert die Feststoff-Batterie nur in Knopfzellengröße. Die Forscher der Deakin-Universität sind jedoch sicher, auch größere Prototypen bauen zu können und wollen sich, wenn ihnen das gelungen ist, um Industriepartner für erste Serien kümmern.

