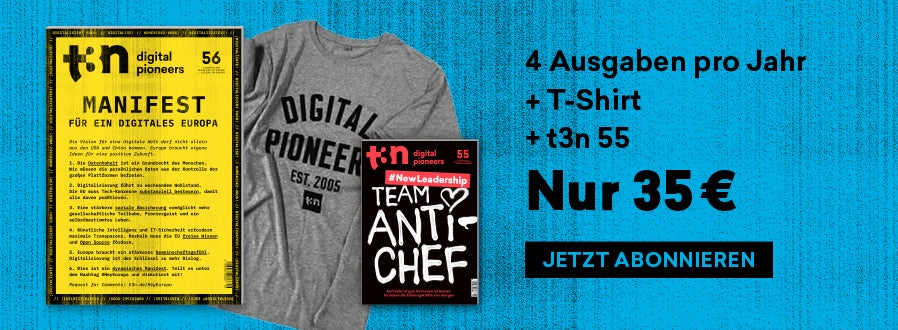Fortnite: Vom Videospiel zum sozialen Massenphänomen

(Screenshot: Epic Games)
Als ein New Yorker Paar im September 2018 seine Hochzeit feiert, hält der anwesende Fotograf eine Szene auf der Tanzfläche fest: Vier Jungs, gerade erst Teenager geworden, stehen in Hemden – einer sogar im Anzug – beieinander, strecken die Arme aus, lachen sich gegenseitig an. Die meisten Kinder auf der Hochzeit, so schreibt der Bräutigam, Anoop Ranganath, später auf Twitter, hätten sich nicht einmal gekannt. Trotzdem trafen sie sich auf der Tanzfläche, denn: „Sie wussten alle, wie man Floss tanzt.“ Ohne sich zu kennen, tanzten die Vier einen der bekanntesten Tänze aus dem Videospiel Fortnite.
Drei Monate später wird sich Ranganath in genau dieses Spiel einloggen und es zusammen mit dem zwölfjährigen Sohn eines Freundes spielen. Mit dabei: die Teenagerfreunde des Jungen, alle über einen Sprachchat verbunden. Und während Ranganath versuchen wird, das Spiel zu gewinnen, erlebt er sprachlos mit, was die Jungs machen: Nicht der Ehrgeiz treibt sie ins Spiel, sondern das soziale Miteinander. Sie zeigen sich einen neuen Song und diskutieren diesen, anstatt sich zu konzentrieren. Die Spielwelt sei für die Kids nur noch Hintergrundrauschen, stellt Ranganath fest: „Die hängen in Fortnite ab, so wie wir früher in Kellern und Hinterhöfen.“ Nach der Partie wird er das Tanzfoto von seiner Hochzeit heraussuchen und mit einigen Gedanken auf Twitter veröffentlichen. Sein Fazit: „Fortnite ist kein Spiel. Es ist ein Ort.“
Millionen Gamer, darunter vor allem Teenager, zieht es Tag für Tag an diesen virtuellen Ort, programmiert vom US-Entwicklerstudio Epic Games. Und zahlreiche Eltern und Erwachsenewenn sie denn nicht selbst spielen – stellen sich die Frage: Warum reden gerade alle über Fortnite? Was ist an dem Spiel so besonders? Und was machen meine Kids da den ganzen Tag?
Fortnite kam Mitte 2017 auf den Markt, in den knapp zwei Jahren seither hat es sich zu einem Spiel der Superlative entwickelt: 250 Millionen Spieler, 2018 einen Gewinn von über 2,4 Milliarden US-Dollar. Und auch wenn niemand weiß, wie lange das noch so weitergehen wird, ob nicht bald schon das nächste, größere, bessere Spiel erscheint, so ist eins doch sicher: Fortnite hat das Gaminguniversum so schnell und radikal verändert wie kaum ein Titel zuvor. Und es kratzt an der Frage, wie Fortnite den Status als reines Onlinespiel hinter sich lassen und zu einer Art sozialem Netzwerk werden konnte.
Der kometenhafte Aufstieg
Einer, der den Hype von Beginn an begleitet hat, ist der 31-jährige Youtuber Stanislav aus Halle (Westfalen). Seinem Kanal Stanplay folgen über eine halbe Million Fans, in seinen Fortnite-Videos beschäftigt er sich nicht nur mit den neuesten Trends, er macht sich auch auf die Suche nach Storylines, analysiert die Spielmechanismen. „Sowas wie mit Fortnite, das passiert nur alle paar Jahre. Es war wie ein Wunder, alles ging Hand in Hand“, sagt er. Fortnite habe sich herumgesprochen, jeder habe sich das angeguckt. „Und natürlich hatten auch die Influencer einen sehr großen Anteil daran“, sagt er.

Der Youtuber Stanislav kündigte seinen Job als Systemadmin – und verdient sein Geld jetzt mit Videos zu Fortnite. Das Spiel sei für ihn als Youtuber ein Geschenk: „Die Ideen kommen von allein“, sagt er. (Foto: Stanplay)
Stanislav selbst hat es Fortnite zu verdanken, dass er seinen Job als Systemadministrator kündigen konnte und sein Geld seit über einem Jahr ausschließlich mit Youtube verdient. Davor spielte er vor allem das Mobile-Game Clash Royale, bis er das Gefühl hatte, hier alles schon mal gesehen und gespielt zu haben. Kaum ein Spiel schafft es, eine relevante Menge an Gamern für mehr als drei bis vier Jahre an sich zu binden. Mit diesem Gefühl im Bauch erinnerte sich Stanislav an Fortnite. Ein Spiel, das zwar schon seit einigen Monaten auf dem Markt war, nun war aber ein Battle-Royale-Modus angekündigt. Ausgerechnet diese kleine – aber entscheidende – Modifikation sollte alles ändern.
Battle Royale, so hieß der damals noch frische Spielmodus, der durch das Spiel Players Unknown Battleground (Pubg) populär geworden ist. Viele Spieler bekämpfen sich auf einem immer kleiner werdenden Terrain, nur der letzte Überlebende gewinnt. Doch Fortnite machte eins anders: Während Pubg und andere erfolgreiche Shooter realitätsnahen Kriegssimulationen ähneln, entführt Fortnite seine Spieler in eine eigene knallbunte Welt. Wer sich einloggt, der hat das Gefühl, Teil seines eigenen Disney-Films zu sein – ganz ohne Blut und freigegeben ab zwölf Jahren. Erstmals musste eine junge Zielgruppe ihren Lieblings-Shooter nicht mehr heimlich spielen, sondern tat es mitten im elterlichen Wohnzimmer.
„Für Youtuber ist Fortnite der Jackpot, der Heilige Gral.“
Dazu setzte Epic Games, der Fortnite-Entwickler, zum ersten Mal auf eine konsequente Multi-Plattform-Strategie: Unwichtig, ob man per Konsole, am Laptop oder auf dem Smartphone spielt, die eigenen Freunde können mitmachen. Auch inhaltlich entwickelte sich das Spiel weiter. Es ging nicht nur darum, Gegner über den Haufen zu schießen. In Fortnite können Spieler alles, was kein Terrain ist, mit einer Spitzhacke zerschlagen, um Holz, Steine und Metall zu sammeln, um daraus uneinnehmbare Forts und virtuelle Baumhäuser zu bauen.
Der Youtuber Stanislav erkannte das Potenzial sofort: Er entschloss sich, auf den Fortnite-Zug aufzuspringen, obwohl niemand ahnen konnte, wie viel Erfolg Epic Games damit haben würde. Die Fortnite-Videos seien am Anfang noch schlecht geklickt worden, erzählt er. Der Youtube-Algorithmus bestrafte ihn dafür, auch seine anderen Videos litten darunter. Dann aber sprang der Funke über, 2018 explodierten die Nutzerzahl und die Aufmerksamkeit in der Fortnite-Welt. Ein Ende ist nicht in Sicht, schließlich sei das Spiel ein fortlaufender Content-Generator, das Perpetuum mobile für Gaminginfluencer. „Für Youtuber ist Fortnite der Jackpot, der Heilige Gral. Die Ideen für meine Videos kommen von allein“, sagt Stanislav. Epic Games liefert neue Inhalte im Wochentakt, er müsse lediglich die neuen Updates nach interessanten Inhalten durchleuchten, nach kleinen Easter Eggs Ausschau halten. Die Videos würden dann hunderttausendfach geklickt werden.

Vier Jungs führen auf einer Hochzeit gemeinsam den berühmten „Floss“-Tanz aus Fortnite auf. Sie kannten sich vorher nicht. (Foto: Riley McLean)
Stanislav ist nicht der einzige Influencer, der es dank Fortnite zu beachtlicher Reichweite gebracht hat. Der wohl größte Profiteur im Influencerbereich: Tyler Blevins, unter dem Namen „Ninja“ bekannt, ist mit fast vierzehn Millionen Followern der erfolgreichste Streamer auf Twitch und verdient mehr als eine halbe Million US-Dollar im Monat. Doch nicht allein diese Summe ist bemerkenswert, auch sein Prominentenstatus geht weit über die Gaming-Bubble hinaus. Der Rapper Drake beispielsweise taucht bei ihm im Stream ebenso auf wie der umstrittene deutsche Internetunternehmer Kim Dotcom. Mesut Özil streamt selbst, der französische Nationalspieler Antoine Griezmann tanzte nach einem Tor „Take the L“ – wie „Floss“, ein Tanz aus Fortnite. Schritt für Schritt schwappen Umgangsformen aus der virtuellen Battle-Royale-Welt über die Pausenhöfe ins echte Leben.
Umstritten ist allerdings, wie langlebig der durch Fortnite geschaffene soziale Raum wirklich ist. Wird er Jahre oder gar Jahrzehnte fortbestehen und zu einem dauerhaften Treffpunkt in der virtuellen Welt werden, wie es Facebook oder Twitter heute sind? Oder verschwindet das Spiel so schnell aus den Köpfen der Spieler wie die einst gehypte 3D-Simulation Second Life? Diese Frage wurde auch nach den Tweets des New Yorkers Anoop Ranganath diskutiert. Kommentatoren erklärten, es handele sich keineswegs um ein neues Phänomen, dass sich Jugendliche in Computerspielen wie auf dem Bolzplatz träfen. Schon bei Onlinerollenspielen wie World of Warcraft sei das der Fall gewesen.
Ein Nutzer bemerkte jedoch: Kann es sein, dass Fortnite aus Versehen das erreicht hat, was die Simulation Second Life erfolglos versucht hat? Tatsächlich gibt es einen Unterschied: Zu Höchstzeiten hatte World of Warcraft zwölf Millionen Spieler, Second Life eine Million. Bei Fortnite sind es nach nicht einmal zwei Jahren bereits 250 Millionen Gamer, Tendenz rasant steigend. So viele Nutzer hatte Facebook erst nach fünf Jahren. Kann ein Computerspiel also auch eines der weltweit größten Netzwerke sein?
Neue Verantwortung für Entwickler
Constance Steinkuehler hat sich mit dieser Frage lange vor Fortnite beschäftigt. Die 49-jährige Informatikprofessorin forscht an der University of California, Irvine, und gilt als Vorreiterin, wenn es um die sozialen Aspekte von Computerspielen geht. 2006 untersuchte sie das Onlinecomputerspiel Lineage auf seine Tauglichkeit als „Third Place“. In der Städteplanung werden so halböffentliche Orte genannt, wie es beispielsweise Kneipen, Kirchen und Bibliotheken sind. Auch ein Computerspiel, so führte Steinkuehler damals aus, könne gerade für Jugendliche Funktionen eines Third Places übernehmen, vergleichbar mit einem Skatepark oder einem Bolzplatz.

Ganz ohne Blut und ab zwölf Jahren freigegeben: Wer sich in Fortnite einloggt, hat das Gefühl, Teil seines eigenen Disney Films zu sein. Gemeinsam schießt man sich über den Haufen – oder baut Festungen und virtuelle Baumhäuser. (Screenshot: Epic Games)
Seit 2006 habe sich in der Spieleindustrie einiges getan, erklärt sie am Telefon. Sie sei gerade auf dem Weg zu einem Fachkongress in San Diego, sagt sie, wo sie an einer Diskussion über E-Sport an US-amerikanischen Bildungseinrichtungen teilnehmen werde. Wenn Universitäten schon Stipendien an Gamer vergeben, sagt Steinkuehler, dann zeige das nicht nur, wie viel Geld in der Industrie stecke. Sondern auch, dass Spiele ein relevanter Teil im Sozialleben vieler junger Menschen seien. Und hier gebe es riesige Defizite: Die Entwickler seien sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung noch nicht bewusst, sagt sie: „Ich bin eine Verfechterin für Spiele geworden, weil ich es befürworte, dass Kinder sich miteinander beschäftigen sollen“, sagt Steinkuehler. „Ich bin aber keine Verfechterin für eine Blankovollmacht der Spieleindustrie.“
Denn Spiele seien soziale Räume, meist mit noch jüngeren Nutzern als Facebook oder Twitter, sagt Steinkuehler. Und wie überall, ob im Internet oder in der echten Welt, gäbe es auch Probleme, wenn Menschen aufeinandertreffen. Sie erzählt davon, wie eines ihrer Kinder beim Spielen Nachrichten mit klaren antisemitischen Äußerungen von einem fremden Profil erhalten habe. Gemeinsam hätten sie Screenshots gemacht, sagt sie, das Profil dem Spieleentwickler gemeldet. „Und was war die Reaktion? Nichts!“, spricht sie sich in Rage. Natürlich sei die Anonymität, so berichten auch Fortnite-Spieler, ein Nährboden für Beleidigungen, Verschwörungstheorien und Mobbing.
Dabei gebe es durchaus Werkzeuge dagegen, sagt Steinkuehler: Algorithmen zum Beispiel, die beleidigende Spieler erkennen oder Community-Manager, die das soziale Engagement der Spieler stärken. „Die Spieleindustrie hat nur nicht den Willen, diese konsequent zu implementieren. Und das Community-Management ist minimal, absolut unterbesetzt.“
Dabei sei es entscheidend, erklärt Steinkuehler, wie genau Spiele als soziale Räume gebaut werden. Sie verwendet hierfür das englische Verb „to engineer“, um eine Sache zu betonen: Genauso wie Lage und Ausstattung eines Skateparks das Verhalten von Teenagern beeinflussen können, so ähnlich ist das auch bei Computerspielen. Tatsächlich zeigt sich der Milliardenkonzern Epic Games mit Blick auf die Blackbox seines Community-Management verschlossen, obwohl die Verantwortlichen für Europa in Deutschland sitzen, mitten in Berlin. Man gebe derzeit allerdings keine Interviews, heißt es dazu lediglich vom Unternehmen.
Die Generationenfrage
Eines, so sagt die US-Amerikanerin Steinkuehler, unterscheide einen digitalen Skatepark wie Fortnite jedoch grundsätzlich von dem realen: „Der Lärm, die Lautstärke, der Konflikt, all das spielt sich jetzt im Wohnzimmer der Eltern ab.“ Weil der Alltag von Kindern und Teenagern heute viel strukturierter sei als noch in ihrer eigenen Kindheit, beschreibt sie, hätten sie aufgrund von Ängsten der Eltern weniger Freiräume in der echten Welt als früher. Die Konsequenz: Eltern könnten die Welt zwar sehen, in der sich ihre Kinder bewegen. Eine Welt, die für Emotionen wie Freude, Trauer, Wut sorgen kann. Doch verstehen könnten Eltern sie nicht.
Mit seinen 49 Jahren dürfte der Schweizer Beat Richert, Dozent für Medienkompetenz, für viele Teenager unter dem Generalverdacht stehen, genau so ein Elternteil zu sein. Er selbst sei kein Videospieler, sagt er, aber er interessiere sich als Vater eines Sohns im Teenageralter für die Gamingwelt. Als das Thema Fortnite im Kinderzimmer und in den Medien aufploppte, ließ Richert sich von seinem Sohn das Spiel erklären. Es sei zu einfach, so stellt Richert fest, nur die Teenager in Verantwortung zu nehmen. Denn oft gebe es auch Probleme auf der anderen Seite der Kinderzimmertür: „Die Elterngeneration versteht die Hypes ihrer Kinder oft nicht und reagiert dann häufig abwertend, versucht den Spielkonsum zu regulieren oder zu verbieten“, erklärt er.
„Die Elterngeneration versteht die Hypes ihrer Kinder oft nicht und reagiert dann häufig abwertend.“
Also schrieb Richert für den Schweizer Tages-Anzeiger einen offenen Brief im Namen der Generation Fortnite: „Papa, darum spiele ich Fortnite!“ Es ist eine launige Argumentationshilfe, die helfen soll, falls die Eltern mal wieder ohne Ankündigung den WLAN-Router ausschalten oder mitten in einer Partie verlangen, dass die Spülmaschine ausgeräumt werden muss. Abgesegnet wurde der Brief von Richerts Sohn und seinem Neffen, 15 und 17 Jahre alt, beides Fortnite-Zocker. In dem Brief werden zehn Werte genannt, die durchs Spielen gefördert werden, etwa soziale Verantwortung und strategisches Denken oder Empathie und Solidarität. Es sind Werte wie aus einer Pfadfinderfibel, und die Parallele ist nicht zufällig: „Wir dürfen nicht vergessen: Das sind die Teenager, die in diesem Spiel auch leben. Das ist ihr wichtiger Schlüssel zur sozialen Interaktion“, sagt Richerts. „Deswegen sollten wir wenigstens ein paar Schritte in den Schuhen der jungen Generation machen.“ Auch wenn es den Kindern peinlich sei, wenn der grau melierte Vater auf einmal denselben Tanz wie Fußballweltmeister Antoine Griezmann aufführt.

250 Millionen Spieler haben sich innerhalb von zwei Jahren bei Fortnite registriert. Facebook, das weltweit größte soziale Netzwerk, benötigte dafür ganze fünf Jahre. (Screenshot: Epic Games)
Diese Vorbildfunktion der Eltern, sagt Richert, sei allerdings ein zweischneidiges Schwert. Das zeige sich vor allem bei dem klassischen Konfliktthema zwischen den Generationen – der Bildschirmzeit. Kinder empfänden es schnell als ungerecht, wenn sie selbst nur dreißig Minuten am Tag ihre Freunde bei Fortnite treffen dürften, während die Eltern bis Mitternacht am Smartphone hingen.
Das andere Extrem, wenn Eltern ihre Kinder gar nicht regulieren, beobachtet Richert, wenn er Schulklassen besucht, um Workshops zur Medienkompetenz zu geben. Oft beginnt er mit einer simplen Übung. Sie soll den Schülern zeigen, dass die direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht gelernt und eben auch wieder verlernt werden kann: Die Schüler sollen sich paarweise voreinander stellen, ihrem Gegenüber tief in die Augen schauen und ausführlich die Augenfarben beschreiben: Ist das ein helles Blau, mischt sich noch ein wenig Grün ins Braune?
Viele von ihnen, so hat Richert festgestellt, spürten ein Unbehagen, sich gegenseitig in die Augen zu sehen. Sie drehten sich weg, es sei ihnen peinlich, jemanden so lange direkt anzuschauen. In den anschließenden Gesprächen zeige sich, erklärt Richert, dass die meisten Schüler ein gutes Gefühl dafür hätten, ob sie zu lange vor Bildschirmen sitzen und ausschließlich digital kommunizieren. Nur fehle es ihnen häufig an der Selbstdisziplin: „Die erwarten dann Regeln von ihren Eltern, sie wollen, dass da eine Hilfe von außen kommt“, sagt Richert.
Fakt ist, dass die Kinder und Teenager, die ihren eigenen Platz im Digitalen suchen, immer jünger werden. Sie nutzen Netzwerke, in denen ihre Eltern nicht präsent sind oder gehen ihnen auf den etablierten Plattformen aus dem Weg: Snapchat ist auch deswegen immer noch erfolgreich, weil die Inhalte, die man produziert, nur einen speziellen Personenkreis erreichen. Bei Teenagern ist es gängige Praxis, mehrere Instagram-Accounts zu haben – einen offiziellen, auf dem auch die Eltern mal vorbeischauen können, und dann weitere für unterschiedliche Freundeskreise und Interessen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die junge Generation ein entscheidender Faktor dabei sein kann, um soziale Netzwerke innerhalb von wenigen Jahren zu Platzhirschen zu machen. So ist es etwa bei der Videoplattform Tiktok geschehen, und so ist es auch bei Fortnite.
Womit nur noch die Frage bliebe, ob sich das erfolgreichste Spiel aller Zeiten auf dem Markt halten kann – oder schon bald vom nächsten Megatitel abgelöst wird. Der Youtuber Stanislav sieht noch keinen Herausforderer am Horizont, das Unternehmen Epic Games habe mit der Inhalteproduktion am Fließband dafür gesorgt, dass das Spiel zu einem zentralen Ort im Leben vieler Gamer und Influencer geworden ist: „Als Spieler wird man ja verwöhnt, weil sich sehr schnell sehr vieles ändert, immer neue Inhalte dazukommen. Andere Entwickler können da nicht einfach so mithalten.“ Informatikprofessorin Steinkuehler sieht das ähnlich. Tatsächlich spreche vieles dafür, dass der Battle-Royale-Shooter seinen Unicorn-Status in nächster Zeit behalten wird. Doch auch die Nischen, die andere Spiele besetzen können, so ist sie sich sicher, werden immer größer: „Es bildet sich gerade eine unglaubliche Diversität auf dem Markt heraus.“ Wichtiger sei, dass wir uns gerade im goldenen Zeitalter des Gamings befänden, sagt Steinkuehler, in dem Spiele eine gesellschaftliche Relevanz hatten wie noch nie: „Ich weiß nicht, wie lange es anhalten wird. Aber wenn es nach mir ginge, hoffentlich für immer.“