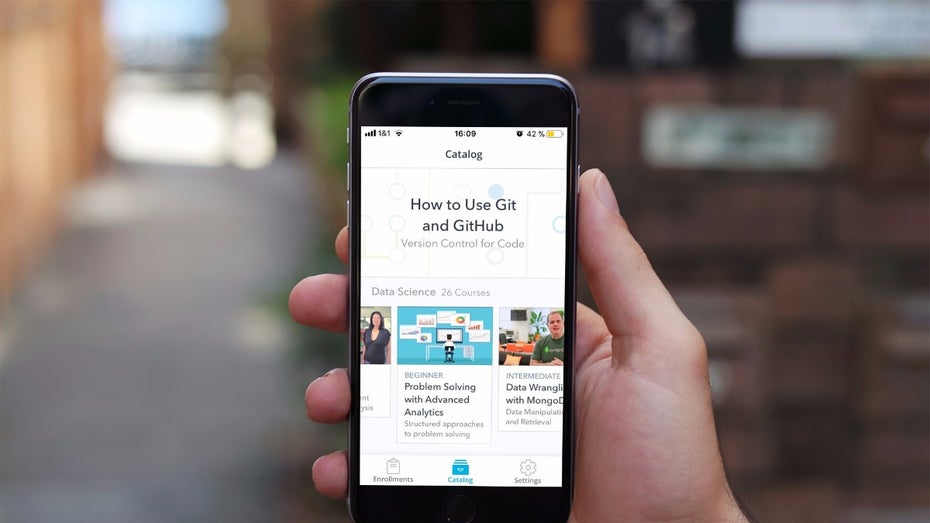Die einen haben mehr, die anderen haben weniger gearbeitet. Für manche Menschen änderte sich wenig, für viele erheblich viel. Blicken wir zurück auf das erste Pandemiejahr, finden wir unzählige Geschichten unter allen Menschen. Die Coronakrise hat so gut wie alle Bürgerinnen und Bürger im Arbeitsalltag beeinflusst. Wir haben die t3n-Community auf Twitter gefragt, wie deren Arbeitsjahr während der Pandemie war. Einige Leserinnen und Leser haben sich für diesen Beitrag ausführlicher geäußert. Sie berichten sowohl von finanziellen Einbußen, Stress, Wut und Tränen als auch von ruhigeren Momenten und einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Acht Menschen erzählen.
„Keine Kunden, keine Kollegen. Nur ich.“
Von Christoph Engels
Vor der Pandemie war ich zu 90 Prozent unterwegs oder im Homeoffice und nur zu maximal zehn Prozent im Büro. Während der Pandemie war ich quasi nur noch im Homeoffice. Keine Kunden, keine Kollegen. Nur ich. In dem Modus arbeiten alle im Team wesentlich stärker für sich. Bis auf einzelne Gespräche bezüglich anfallender To-dos, hatte ich selten Kontakt innerhalb des Unternehmens. Erschwerend kam noch hinzu, dass ein Teil in Kurzarbeit war. Ich fühlte mich dadurch schon etwas alleine. Wir haben versucht, das durch Online-Formate abzufedern. Wöchentliche Update-Video-Meetings innerhalb des Teams beispielsweise, in denen alle auch Sachen aus dem privaten Umfeld sagen durften und sollten, sowie auch etwas, das man in der letzten Woche vielleicht gelernt oder an interessanten Dingen gelesen hat. Natürlich frisst sowas Zeit, es ersetzt aber ein wenig den fehlenden Kaffee-Talk. Durch Corona habe ich erfahren, wie wichtig mir eigentlich der Kontakt zu Kunden und Kollegen ist, egal, wie trivial er manchmal auch sein mag.
„Wo ist die Mitmenschlichkeit geblieben?“
Von Ingeborg Trampe
Ich erinnere mich noch sehr gut an den Beginn der Pandemie. Wir mussten den runden Geburtstag meiner Mama absagen. Von da an war klar, es ist ernst. Ich hatte Glück, meine Kunden haben alle weitergemacht. Darüber hinaus habe ich sogar noch ein großes neues Mandat gewonnen. Ich musste mir also keine existenziellen Sorgen machen. Und ich komme prima alleine zurecht, fühlte mich weder einsam, noch gelangweilt. Videocalls waren eine positive Entdeckung. Nicht zu reisen, war für mich eine Entlastung. Wir alle lernten miteinander, digitaler zu arbeiten. Jeder war mitfühlend, das Tempo wurde etwas gedrosselt. Wir waren eine Gemeinschaft gegen das Virus. Ein Jahr später ist die Situation eine völlig andere: Aktionismus und Empathielosigkeit sind auf dem Vormarsch. Das Hamsterrad dreht sich schneller denn je. Kunden versuchen aus Verzweiflung, Dinge zu erzwingen. Videocalls sind längst keine Freude mehr. Wir sind alle leer und müde. Ich schätze, es wird ein hartes Jahr. Wir müssen uns auf Mitmenschlichkeit zurückbesinnen.
„Ich habe gelernt, mich wieder zu langweilen.“

1 Jahr Coronakrise: „Für diese neu gelernte Ruhe bin ich der Pandemie fast schon dankbar.“ (Foto: Hypr)
Von Giuseppe Rondinella
Es mag kurios klingen, aber für mich war das vergangene Arbeitsjahr tatsächlich erholsamer als sonst. Das liegt in erster Linie daran, dass glücklicherweise niemand aus meinem Familien- und Bekanntenkreis ernsthaft am Coronavirus erkrankt ist – ich selbst auch nicht. Und daran, dass ich einen vergleichsweise krisenfesten Job in einer Public-Relations-Agentur habe. Toi, toi, toi. Erholsam gestaltete sich mein vergangenes Jahr aber vor allem deshalb, weil ich wieder gelernt habe, mich in meiner Freizeit bewusst zu langweilen, die Ruhe zuzulassen und das Nichtstun zu akzeptieren. Einfach mal auf die Couch legen und eine halbe Stunde an die Decke schauen – das erzeugt ungeheure Kreativitätsschübe, die sich auch positiv auf mein Berufsleben ausgewirkt haben. Ich bin mir sicher: Ohne das Coronavirus würde ich heute die Fähigkeit des bewussten Langweilens nicht besitzen und stattdessen, wie zuvor, weiter ganz FOMO-mäßig dem nächsten digitalen Adrenalin-Kick hinterherjagen. Für diese neu gelernte Ruhe bin ich der Pandemie fast schon dankbar.
„Digitalisierte Arbeit ist endlich angekommen.“
Von Christian Frank
Natürlich vermisse ich meine Familie und ich sehe auch Freunde viel zu wenig während dieser Tage, aber was meine Arbeit angeht, war die Pandemie bisher wirklich sehr gut zu mir: Ich gehöre zu der Gruppe von Menschen, die gut im Homeoffice arbeiten können. Ich bin freiberuflich in der IT für mehrere Kunden an verschiedenen Orten und in verschiedenen Ländern tätig und mit der Pandemie hat endlich eine umfassende Digitalisierung der Arbeit begonnen. Ich habe bis heute sehr viele Projekte komplett virtuell abgewickelt – von der Akquise bis hin zur Abrechnung und ich bin begeistert, wie unkompliziert und einfach das sein kann. Auch wenn wir im Moment nicht reisen können, so eröffnet uns die Digitalisierung der Arbeit doch eine ungeahnte Flexibilität: Ich kann am gleichen Tag morgens ein Meeting in Frankfurt haben, danach einen Workshop in Kopenhagen halten und zum Ende des Tages an einem Jour-Fixe in München teilnehmen. Die Pandemie beschränkt mich auf der einen Seite, auf der anderen beflügelt sie aber auch.
„Virtuelle Teilhabe hat das Zeug zur Inklusion.“
Von Judith Braun
Ich habe ein erwachsenes Kind mit Behinderung und so grundsätzlich herausfordernd das Leben als pflegende Angehörige ist, meine gleichzeitige Berufstätigkeit hat sich in der Pandemie deutlich vereinfacht. Davor glich beispielsweise ein Konferenzbesuch der Planung einer Weltreise. Gibt es einen bezahlbaren Platz in der Kurzzeitpflege? Gibt es eine optimale Taktung für einen eventuellen Arztbesuch? Wie steht es generell um die Fahrt zur entfernten Einrichtung und von da aus um die Weiterreise zum Termin? Danach die ganze Nummer natürlich auch wieder rückwärts. Wie einfach gehts aktuell: An den eigenen Schreibtisch setzen, Laptop anschalten und man ist überall dabei. Die durch die Pandemie beschleunigte virtuelle Teilhalbe hat eindeutig Potential für echte Inklusion. Ich bin dankbar, dass meine Firma mir aktuell komplett Homeoffice ermöglicht hat und auch für danach auslotet, wie sich das Beste aus beiden Welten verbinden lässt. Ich hoffe, dass auch Eventveranstalter zukünftig immer eine hybride Variante mitdenken.
„Ich habe immerhin keine existentiellen Ängste.“

1 Jahr Coronakrise: „Ich habe Tage, an denen ich vor Wut und Ohnmacht weine.“ (Foto: Vivian Balzerkiewitz)
Von Anna-Lena Müller
Mein Arbeitsjahr war insbesondere während der ersten Welle im Frühjahr 2020 stressig: Denn remote arbeiten bedeutet nicht nur mehr, sondern vor allem auch eine ganz andere Art der Kommunikation. Es ist ein Unterschied, ob wir online kommunizieren oder mit den Kolleginnen und Kollegen im Büro zusammensitzen und uns schnell über den Schreibtisch abstimmen können. Die wertvollen Gespräche vor und nach den Meetings, der Smalltalk und das Zwischenmenschliche – so sehr ich digitale Lösungen liebe, viel Wichtiges bleibt auf der Strecke. Und wenn auch an mir die Pandemie nicht spurlos vorbeigeht, ich Tage hatte und habe, an denen ich vor Wut, Hilflosigkeit und Ohnmacht weine und erschöpft bin, so bin ich mir meiner Privilegien in den vergangenen Monaten noch bewusster geworden und schätze diese noch mehr: Ich habe einen sicheren Bürojob und kann ihn im Grunde problemlos aus dem Homeoffice erledigen. Umso größeren Respekt habe ich darum vor allen, bei denen das nicht der Fall ist.
„Ich habe erhebliche finanzielle Einschnitte.“
Von Laura Mitrach
Ich arbeite als Eventmanagerin und unsere Branche hat die Pandemie besonders stark getroffen. Ich bin seit einem Jahr in Kurzarbeit. Durch das Kurzarbeitergeld könnte man jetzt annehmen, das sei wie bezahlter Urlaub. Aber der Schein trügt. Ich muss schon mit erheblichen finanziellen Einschnitten klarkommen. In der Folge habe ich mir mehrere Nebenjobs besorgt, die allerdings auch – je nach Lockdown ja oder nein – mal wegbrechen und dann ganz plötzlich wieder da sind. Es sind also viele neue Herausforderungen entstanden, mit denen ich umgehen muss. Die fehlende Planbarkeit und das Hin und Her strengen an. Außerdem liebe ich meinen Eventjob und kein notgedrungener Nebenjob der Welt kann einem das geben, was mein eigentlicher Beruf mir gibt. Ja, es könnte natürlich alles noch viel schlimmer sein und ich gehöre auch zu denen, die den Lockdown als ein wichtiges Instrument zum Infektionsschutz akzeptieren. Und trotzdem: Ich wünsche mir, dass wir schnell wieder in den Normalzustand kommen.
„Wild, lebendig und lehrreich.“
Von Tatjana Fichtner
Es ist, als würde man beim Loslaufen ins Stolpern geraten, weil man von der eigenen Geschwindigkeit überrascht ist. So erging es mir zumindest im Pandemiejahr. Von zu Hause aus arbeiten, bedeutet für viele Menschen im „Nicht stören“-Modus volle Konzentration zu haben, aber auch keine Cafeteria-Treffen mehr. Stattdessen füllt sich mein Kalender mit Videokonferenzen. Erst waren es routinierte einstündige Termine, doch schnell fiel uns auf, dass auch maximal 30 Minuten für den wesentlichen Austausch genügen. Zudem entfallen Wegzeiten. Dadurch passen jedoch noch mehr Themen in dieselbe Anzahl der Arbeitsstunden. Das ist aufregend, weil natürlich wirklich viel voran geht. Es ist aber auch ein anstrengender Balanceakt: Nur durch die Disziplin, auch Ruhepausen aktiv mitzuplanen, sie zu kommunizieren und sie einzuhalten, wurde aus dem anfänglichen Stolpersprint ein nachhaltiger Marathon, der uns als Team voranbringt und zusammenschweißt. Die Pandemie brachte eine hohe Schlagzahl, mit der wir umgehen lernten.
1 von 15