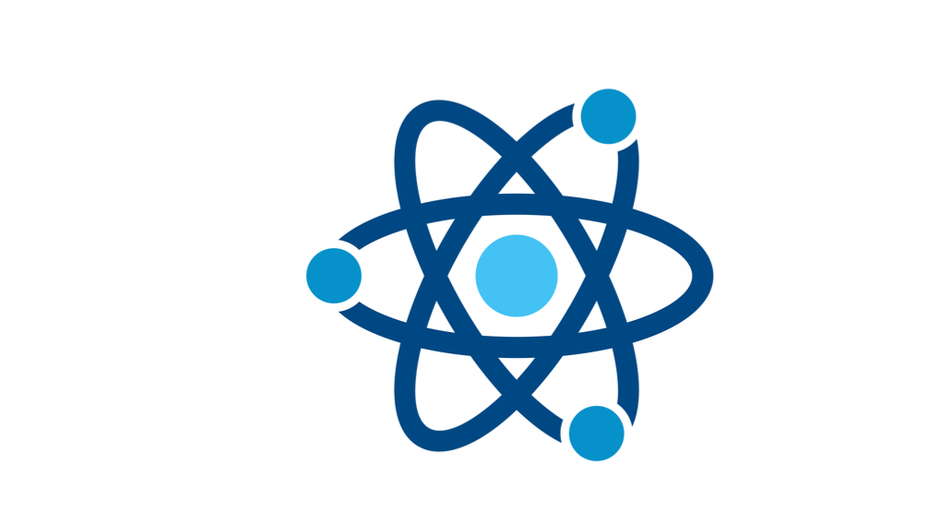
Die Welt der digitalen Endgeräte wird immer vielfältiger. Euer Design muss sich anpassen. (Bild: Shutterstock)
Als Design noch opulent, wenn auch nicht zwangsläufig schön war
Was waren das doch paradiesische Zeiten. Designer gestalteten für ein rechteckiges Seitenformat und stritten allenfalls darüber, ob sie nun für 800 x 600 oder 1.024 x 768 Pixel optimieren sollten. Fähigkeiten, die die Browser nicht hatten, wurden per Plugin (Flash, Java und Dutzende weitere) nachgerüstet. So war das Web schon vor über zwanzig Jahren dynamisch, bewegt und unterhaltsam.

Schon vor fünfzehn Jahren waren Hero-Bereiche in. Mit Flash war eigentlich alles in Hero-Optik. Dieses Beispiel war sogar parallax. (Screenshot: Smashing Magazine)
Dann kam die erste Welle digitaler Handgeräte. WAP, das Wireless Application Protocol, sollte sich als Technologie für den mobilen Internetzugriff etablieren. Es kam mit einer eigenen Auszeichnungssprache und sollte die Datenmenge, die über die mobilen Leitungen ging, drastisch reduzieren. Viel mehr als ein Datex-J auf Steroiden kam dabei nicht heraus. Dennoch, wer etwas auf sich hielt, der hatte eine eigene WAP-Seite im Angebot. So richtig viele waren es nicht.
Aber dann kam das iPhone, kurze Zeit später Android und alles änderte sich. Das schöne Design-Rechteck wurde gesprengt. Plötzlich waren die Screens höher als breit und die denkbaren Auflösungen vermehrfachten sich schneller, als Designs darauf angepasst werden konnten.
Mit dem responsiven Design glaubten wir, eine Antwort gefunden zu haben auf das Auflösungschaos unserer digitalen Endgeräte. Da traten die Smartwatches auf den Plan und wieder musste neu gedacht werden.
Aktuell verbreiten sich Sprachassistenten in Hardware rasant. Vor allem Amazon sorgt mit den sehr niedrigen Preisen seiner Echo-Hardware für eine schnelle Durchdringung. Googles Produkte orientieren sich preislich in der Nähe. Hardware mit Sprachassistenz ist zum Spontankauf geworden.

Der Amazon Echo der dritten Generation. (Foto: Amazon)
In Autos finden sich ebenfalls mehr und mehr intelligente Lösungen. Hinzu kommen Smart-TVs, intelligente Sound-Systeme wie das Sonos sowie haufenweise Geräte, die dem Internet of Things ansonsten zugeordnet werden können.
Du musst dein digitales Angebot omniverfügbar machen
Wer ein digitales Produkt verkauft oder über das Digitale Produkte verkauft oder Dienste anbietet, der wird ein Interesse daran haben, auf möglichst vielen dieser Endgeräte mit seinem Angebot präsent zu sein. Selbst wenn ihr das anders seht – eure Kunden werden erwarten, dass sie euer Angebot auf all ihren Geräten gleichermaßen bequem nutzen können. Und wenn ihr diesem Wunsch eventuell nicht entsprechen wollt, könnt ihr sicher sein, dass es einer eurer Wettbewerber auf jeden Fall tun wird. Insofern habt ihr nicht wirklich eine Wahl. Google übt zusätzlichen Druck aus und stellt seine Indexierung auf Mobile-first um.
Ihr steht also vor dem Problem, euer digitales Angebot über eine breite Vielfalt an Endgeräten unterschiedlichster Spezifikation, mit Screen und ohne, nahtlos vorhalten zu müssen. Der Designansatz, der das ermöglicht, wird Atomisation, also Atomisierung, genannt.
Zerleg deinen Dienst in atomare Teilchen
Das Konzept der Atomisierung geht davon aus, dass ein Design in kleinste Einheiten zerlegt werden muss, um es über eine breite Zahl möglicher Endpunkte konsistent ausliefern zu können. Atomisierung kann dabei sogar bedeuten, dass der Service als solcher sich ganz in seine Bestandteile auflöst und in wechselndem Kontext, eventuell sogar als Teil eines Drittangebots wieder auftaucht.
Benachrichtigungssysteme
Den letztgenannten Fall markieren etwa die immer stärker werdenden Notifikationssysteme auf Smartphones, Windows oder macOS. Hier werden kleine Informationshäppchen oder Steuerungselemente typischerweise im kartenbasierten Design außerhalb des eigentlichen Markenkontext angezeigt. Ohne dass ihr eine Wetter-App oder den Terminkalender starten müsst, zeigt euch euer Benachrichtigungs-Stream an, ob es regnet und wann ihr zum Zahnarzt müsst. Die App-Logik ist zwar installiert, aber nicht für die Anzeige erforderlich.

Nutzer konsumieren heutzutage, wo und wann sie wollen. (Foto: Shutterstock)
Inzwischen entwickeln sich die Benachrichtigungssysteme weiter und bieten für verschiedene Apps bereits jetzt die Möglichkeit, die nächste logische Folgeinteraktion, beispielsweise das Beantworten eines Tweets, direkt aus der Benachrichtigung heraus zu erledigen. Die eigentliche App muss dafür nicht gestartet werden.
Kein oder nur ein minimales Userinterface
Noch interessanter wird es, wenn ihr euren Dienst auch in Geräten vorhalten wollt, die über kein oder nur ein minimales visuelles Interface verfügen. Das Paradebeispiel für diese Form der Design-Atomisierung ist Spotify. Spotify läuft nahtlos über den Desktop, Smartphones, Tablets, Smart-TVs, die Playstation, in Autos von Ford, BMW, Volvo und anderen und sogar auf Soundsystemen von Sonos, Pioneer, Sony und weiteren; nicht zu vergessen die Dosenintelligenz des Google Home oder der Echos.

Viel Platz für eine visuelle UI bleibt da nicht. (Foto: Shutterstock)
Um diese Omnipräsenz zu erreichen, musste Spotify seinen Dienst designtechnisch in atomare Teilchen zerlegen. Als monolithische Desktop-Anwendung lässt sich der Dienst nicht auf die Apple Watch bringen, geschweige denn aufs Sonos.
Probleme, die du vorher nicht hattest
Die Atomisierung des Dienstes ist für selbstbewusste Markeninhaber kein Zuckerschlecken, denn sie erfordert stets, Kontrolle abzugeben. Ihr könnt eure Marke nicht mehr in der gleichen Weise kontrollieren, wie ihr es könntet, wenn ihr die Umgebung vollständig beeinflussen könntet. Gerade ältere Marken werden daran zu knacken haben. Ich kann mich noch gut an Corporate-Design-Richtlinien früherer Kunden erinnern. Die hatten teils Telefonbuchstärke.
Gleichzeitig ist es natürlich erforderlich, Kontur zu bewahren und als Marke erkennbar zu bleiben. Sonst wird man von der technischen Plattform, auf der man präsent sein will, quasi absorbiert und findet im Kundenbewusstsein nicht mehr eigenständig statt. So lässt sich keine Kundenbindung schaffen.
Spotify löste die Aufgabe, indem es sich auf das Logo und das Farbschema konzentrierte und keine weiteren Branding-Elemente schuf. So ist der Dienst jetzt über alle Devices am grünen Logo eindeutig zu erkennen.

Auf der Gear Fit ist nun wirklich kaum Platz. Spotify bleibt trotzdem erkennbar. (Foto: Spotify)
Wichtig im Zuge der Atomisierung ist es zudem, auf Konsistenz zu achten. Soweit das jeweilige Gerät es zulässt, sollten wesentliche Bedienelemente stets an der gleichen Stelle zu finden und/oder stets auf die gleiche Weise zu bedienen sein. Hier hat es Spotify mit seiner Kernfunktionalität leicht. Immerhin ist diese direkt den gängigen Player-Controls entlehnt.
Unterschiedliche Endgeräte haben unterschiedliche Fähigkeiten
Zur Atomisierung als Designprinzip gehört es ebenso, die Fähigkeiten der jeweiligen Endgeräte gezielt zu nutzen. So kann Spotify auf dem Smartphone etwa auf die Laufgeschwindigkeit reagieren. In Google Notizen können Nutzer sich ortsbasiert zum Beispiel daran erinnern lassen, neuen Rasierschaum zu kaufen, wenn sie gerade in der Nähe der Drogerie sind. Fitness-Apps nutzen GPS oder Pulsmesser-Features und synchronisieren diese über den Dienst insgesamt. Für den Anwender muss sich die Bedienung des Dienstes homogen anfühlen. Egal, mit welchem Gerät er ihn nutzt.
Fazit: Atomisierung vergrößert eure Reichweite
Wer seine Services fachgerecht filetiert und bedarfsgerecht neu zusammensetzt, hat es verhältnismäßig leicht, geräteübergreifend präsent zu sein. Er muss allerdings bereit sein, ein Stück weit Kontrolle abzugeben.
Der Beitrag wurde am 1. November 2020 umfassend überarbeitet.


„Als monolithische Desktop-Anwendung lässt sich der Dienst nicht auf die Apple Watch bringen, geschweige denn aufs Sonos.“
Das schnalle ich nicht. Inwiefern ist Spotify für die Apple Watch oder Sonos angepasst?
Es gibt bis dato doch gar keine Spotify-App für die Apple Watch. Spotify lässt sich lediglich über die generische „Now Playing“-App von Apple steuern.
Weiterhin haben Sonos-Geräte kein eigenes grafisches Interface. Man bedient sie entweder über die Sonos-App für Smartphones/Desktops oder streamt Musik direkt aus der Spotify-App darauf.
Genau das wird in diesem Artikel doch berichtet. Sie geben Kontrolle ab, um den Service aufs Device zu bringen, nicht die App.