Emotionen im Job? Wieso ihr Gefühle in eure Entscheidungen einfließen lassen solltet
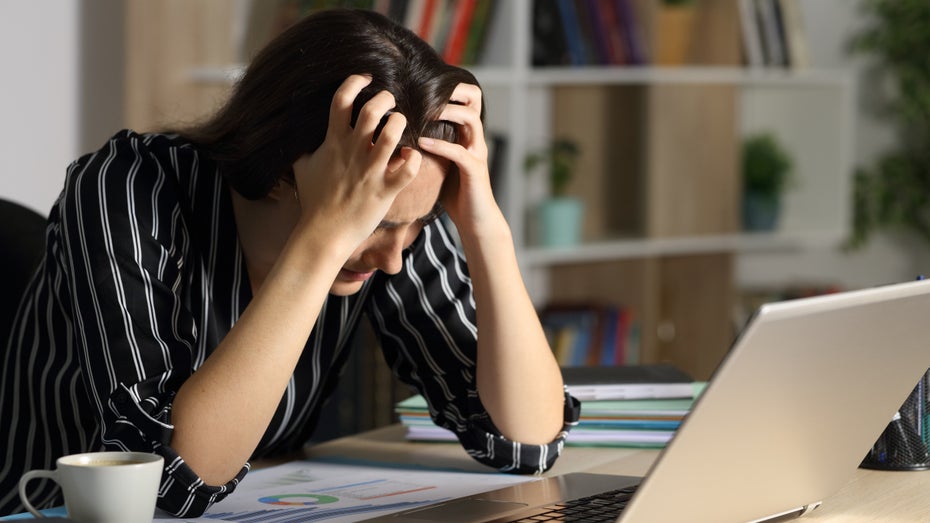
Gefühle werden in der Gesellschaft häufig nicht ernst genommen. (Foto: Pheelings media / shutterstock)
Gefühle sind bei Strafe verboten. Wer Gefühle zeigt, der wird dafür sanktioniert: Die Fähigkeit, klug zu entscheiden, wird angezweifelt, Führungsqualität wird abgesprochen, Gestaltungsmöglichkeiten im Unternehmen werden begrenzt. Gefühle sind gefährlich.
Zugeben würde das im Jahr 2022 niemand mehr, doch verankert ist diese Wahrnehmung noch immer. Kaum jemand ist aufgewachsen ohne „jetzt reiß dich mal zusammen“, „große Mädchen weinen nicht“, „sei nicht so emotional“ oder „so kann ich dich nicht ernst nehmen“.
Die Gesellschaft hat sich geeinigt, Gefühle nicht ernst zu nehmen, um Menschen zu unterdrücken. Schön blöd, dass Gefühle nicht weggehen, nur weil man sie nicht zugibt. Im Gegenteil: Menschen fühlen. Gefühle ermöglichen Kooperation. Vertrauen, Zusammengehörigkeit, Sympathie, Bewunderung sind einige der positiven.
Kritischer gesehen werden Neid, Angst, Wut, Misstrauen. Stresshormone reduzieren die Wahrnehmung verfügbarer Optionen und beeinträchtigen die Risikobewertung. Wut kann zu Entscheidungen verleiten, die der jeweiligen Lage nicht gerecht werden. Zufriedenheit kann träge machen.
Rationalität tötet
Aber auch diese Gefühle dienen der Arbeit und dem Zusammenleben, wenn sie richtig moderiert werden. Diese Moderation lernen Menschen nur, wenn Gefühle im professionellen Kontext grundsätzlich erlaubt sind. Werden die Gefühle dagegen unterdrückt, mehren sich im Körper die Stresssymptome.
Nehmen wir zur Erklärung das Beispiel des Ärgers über einen Kollegen: Der Ärger ist ausgelöst, die ärgerliche Person möchte den Ärger aber nicht zugeben und bemüht sich, Gleichmut oder Freundlichkeit zu zeigen.
Die Psyche verteidigt gleichzeitig ihre Einschätzung der Situation, der Ärger bleibt also bestehen und mit ihm die Stresshormone. Die Stresshormone können nicht abgebaut werden, denn dafür bräuchte der Körper Bewegung oder eine tröstende Berührung – beides widerspräche dem Versuch, Coolness zu demonstrieren. Stresshormone lösen weiterhin Symptome aus, der Ärger bleibt.
Eine Langzeit-Studie der Universitäten Harvard und Rochester deutet auch darauf hin, dass Menschen früher sterben, wenn sie ihre Gefühle unterdrücken. Und eine Studie der Universität Texas besagt, dass Gefühle stärker werden, wenn sie nicht rausdürfen.
Höflichkeit führt zu Burn-out und Rationalität zu schlechten Entscheidungen. Und nicht-emotionale Menschen sind die emotionalsten von allen.
Gefühle formen Entscheidungen auch gegen den Willen
Wer versucht, ohne den Einfluss von Gefühlen zu entscheiden, macht sich damit nicht nur krank. Er betrügt sich auch selbst. Denn die Gefühle gehen nicht weg, nur weil sie unwillkommen sind. Eine Meta-Studie von Wissenschaffenden mehrerer US-amerikanischer Universitäten, darunter die Universität Harvard, differenziert dabei zwischen Gefühlen, die von Dauer sind, und solchen, die eher situativ auftreten.
Situative Gefühle sind dabei eher besorgniserregend, denn sie können dazu führen, dass kurzfristige Reaktionen Entscheidungen auf eine Art beeinflussen, die auch die entscheidende Person langfristig nicht will. Wohlgemerkt: können – nicht: müssen.
Wer guter Stimmung ist, bewertet eine Investition möglicherweise optimistischer, als angemessen wäre. Dies führt zwar zu einer schlechten Entscheidung, über das Ergebnis sagt die Qualität des Entscheidungsprozesses aber erst einmal nichts aus.
Wer im Wald vor einer harmlosen Blindschleiche flüchtet, wird höchstwahrscheinlich überleben. Wer ein Krokodil streicheln will, kann das versuchen, hat aber sicherlich schlechtere Chancen.
Spannend wird es bei den langfristigen Gefühlen. Um beim Beispiel der Investitionen zu bleiben: Wer eine starke Angst vor dem Klimawandel verspürt, wird eher in nachhaltige Projekte investieren. Auch diese Entscheidung führt in Einzelfällen zu unterschiedlichen Ergebnissen.
So gelingt der Umgang mit Gefühlen
Wer seine Gefühle kennt, der kann auch mit ihnen arbeiten. In unserem Beispiel würde das bedeuten: Die Person macht sich bewusst, dass ihre Entscheidungen durch ihre Angst beeinflusst sind und recherchiert zusätzliche Fakten, um Gefühle und Sachlage zusammenzubringen. Und dann darf die Entscheidung auch dem Gefühl folgen: Niemand muss gegen seine eigene Angst entscheiden.
Wer sich selbst gut kennt, wird leichter zu Entscheidungen kommen, die dem Gefühl und der Sachlage gleichzeitig gerecht werden. Und Projekte, die sich nicht gut anfühlen, müssen nicht durchgezogen werden – es gibt genügend andere in der Welt.
Denn eines vergessen jene, die für emotionslose Entscheidungen plädieren: Die Gefühle sind am Ende Teil der Bilanz. Wer negative Gefühle im Entscheidungsprozess beiseiteschiebt, der schafft sich selbst eine Verbindlichkeit.
Und was tun mit den akuten Gefühlen? Wer weiß, was er fühlt, kann dem mit Argumenten entgegentreten. Warten könnte in einem solchen Fall die nachhaltigste Strategie sein. Euphorie macht unvorsichtig, Angst macht gierig, Wut macht hektisch. Aber all das geht auch wieder vorbei.

