Setz‘ deine Ideen frei: 7 Kreativitätstechniken, passend für jede Situation
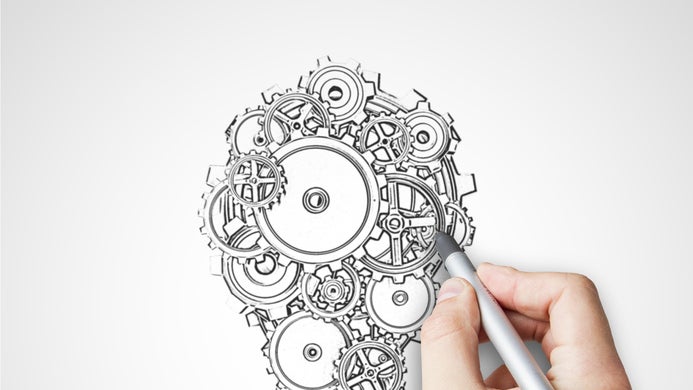
Kreativitätstechniken helfen Ideen zu skizzieren. (© peshkov - Fotolia.com)
Im Jahr 1919 erkannte der Autor und Philosoph Alex F. Osborn, der in der amerikanischen Werbebranche tätig war, dass angesetzte Arbeitstreffen den Einfallsreichtum der Mitarbeiter oft eher begrenzten statt förderten. Das hing auch und gerade damit zusammen, dass sie nicht so recht wussten, wie sie beim Ideenfindungsprozess vorgehen sollten. Osborn versuchte das zu ändern und legte Regeln fest, die einen abgesteckten Raum boten und die den Teilnehmern schlussendlich wieder mehr Freiheit gaben. Das klingt kurios, da Regeln in den Köpfen der meisten Menschen eher Grenzen abstecken, als sie auflösen – jedoch ist das nicht zwangsweise ihre Natur.
Eingangsmethoden nutzen, um Ideen zu sammeln
Was der Werber damals versuchte war, den Mitarbeitern ihre Angst zu nehmen etwas falsch zu machen: Übe keine Kritik! Je mehr Ideen, desto besser! Ergänze und verbessere bereits vorhandene Ideen! Je ungewöhnlicher die Idee, desto besser! Das sind die Grundpfeiler, die er für seine Arbeitstreffen festlegte und die bis heute, die wohl bekannteste Kreativitätstechnik ausmachen – das Brainstorming.
Doch es gibt noch unzählige weitere Techniken, die nicht weniger interessant und die in manchen Situationen sogar erfolgsversprechender sind. Ein Beispiel ist das Brainwriting-Prinzip. Während sich beim Brainstorming extrovertierte Teilnehmer oft mehr als introvertierte Teilnehmer in Gesprächsrunden einbringen, wird beim Brainwriting jeder gleichermaßen integriert. Die Mitarbeiter sitzen im Kreis und jeder bekommt einen Zettel auf dem sie ihre Ideen formulieren. Im Anschluss werden die Zettel an den rechten Nachbarn weitergereicht und können entweder ergänzt, mit einem Gegenvorschlag versehen oder – insofern nichts dazu einfällt – einfach in der nächsten Runde unkommentiert weitergereicht werden.
Beide Kreativitätstechniken sind sogenannte Eingangsmethoden, deren Ziel es ist, lose Vorschläge zu sammeln, um als Impulsgeber zu dienen – in der Regel bleiben die Ideen dabei ohne Kritik.
Walt Disney stand auf Rollenspiele

Kreativitätstechniken: Der Visionär Walt Disney stand auf Rollenspiele. (Bild: Flickr-Orange County Archives / CC-BY-2.0)
Anders ist das bei den sogenannten Rollenspielen. Hier wird der Kritikgeber als fester Teil des Ideenfindungsprozesses angesehen. Die Walt-Disney-Methode baut beispielsweise genau darauf auf. Sie geht auf den US-amerikanischen Autor Robert B. Dilts zurück, der über den Filmproduzenten Disney schrieb: „…there were actually three different Walts: the dreamer, the realist, and the spoiler“ (– der Träumer, der Realist und der Miesepeter). Der Träumer tritt als Ideenfinder, der Realist als Macher, der Miesepeter als der unbequeme Fragensteller auf. Walt Disney betrachtete Visionen grundsätzlich aus diesen verschiedenen Blickwinkeln um Probleme zu erkennen, sie scharf zu zeichnen und schlussendlich zu lösen. Einige Jahre später wurde das Verfahren sogar noch um einen vierten Blickwinkel ergänzt, den des Neutralen, der den Prozess beobachten soll.
Ganz ähnlich funktioniert auch die 6-Hüte-Methode. Teilnehmer bekommen unterschiedlich farbige Hüte aufgesetzt. Jede Farbe symbolisiert eine Geisteshaltung: Der weiße Hut steht für analytisches Denken, der rote Hut für emotionales Denken und Empfinden, der schwarze Hut für kritisches Denken, der gelbe Hut für optimistisches Denken, der grüne Hut für kreatives und assoziatives Denken und der blaue Hut für ordnendes und moderierendes Denken. Die Methode eignet sich vor allem um komplexere Aufgabenstellungen zu beleuchten oder bereits erarbeitete Lösungen weiter zu optimieren.
Problem- und Zieldefinitionen anhand von Checklisten erarbeiten
Wer – wie Walt Disney – fähig ist, die verschiedenen Perspektiven einzunehmen und sie unvoreingenommen zu durchdenken, darf sich getrost als etwas Besonderes bezeichnen. Denn kaum jemand kann seine eigene Vision dermaßen auf den Prüfstand stellen. Alle anderen, die zudem nicht auf ein Team zurückgreifen können, sind mit Checklisten gut beraten. Auch hier wurde das berühmteste Beispiel von Alex F. Osborn begründet. Die sogenannte Osborn-Liste besteht aus 62 Fragestellungen, die in sieben Handlungsansätze unterteilt werden können: Kann eine bestimmte Sache angepasst, vergrößert, verkleinert, ersetzt, umgeordnet, umgekehrt oder vielleicht sogar anders verwendet werden? Projektleiter sollen alle in Ansätze unterteilte Fragen nacheinander abarbeiten, um das übergeordnete Ziel zu erreichen: Veränderung!
Ähnlich funktioniert auch das CATWOE-Prinzip, eine sehr klassische Analysetechnik, die dabei hilft neue Herausforderung zu zerlegen und Probleme differenziert zu betrachten. In dem Rahmen wird jedoch nicht nur die Sache an sich geprüft, sondern wie sie auf äußere Faktoren wirkt. Dabei steht jeder Buchstabe für einen Umgebungsfaktor: C steht für Customer (Kunde), A steht für Actor (Darsteller), T steht für Transformation Process (Transformations-Prozess), W steht für World View (Weltanschauung), O steht für Owners (Eigentümer) und E für Environmental Constraints (Natürlich Grenzen). CATWOE ist also quasi ein Kunstwort für eine Checkliste zur Problem- oder Zieldefinition. Sie wurde von Peter Checkland und Jim Scholes publiziert.
Nützt alles nichts, wenn’s kein Spaß macht
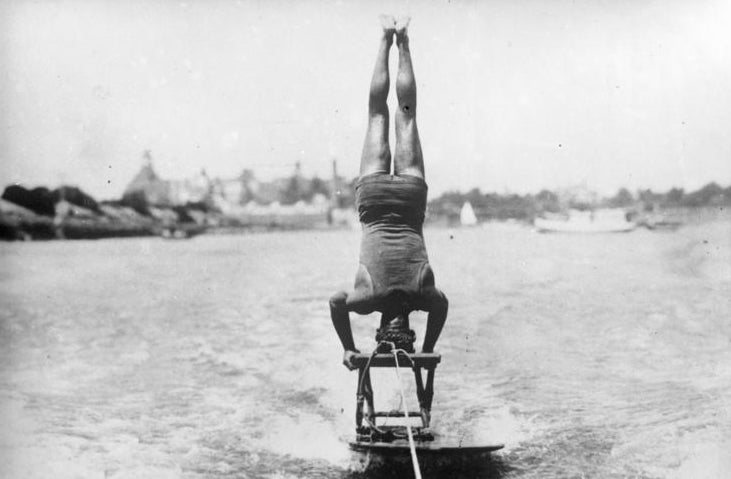
Ungewöhnlich, aber witzig: Die Kopfstandmethode, nur eine von vielen Kreativitätstechniken. (Bild: Wikimedia-Bundesarchiv / CC-BY-SA)
Experten sprechen von in etwa 200 verschiedenen existierenden Kreativitätstechniken. Welche die richtige ist, um effektiv agieren zu können, hängt im Endeffekt stark von den Teilnehmern ab – sie zu Höchstleistungen zu motivieren, steht im Vordergrund. Wichtig ist dabei vor allem, dass die ausgewählte Methode eine gehörige Portion Spaß mitbringt, denn schon der deutsche Aphoristiker Peter Rudl sagte, dass Kreativität der natürliche Feind der Langeweile ist. Wie soll also umgekehrt aus langweiligen Umständen ein kreatives Leuchtfeuer entstehen?
Zu diesem Zweck können auch ruhig einmal ungewohnte Wege bestritten werden: Die Kopfstandmethode beispielsweise bringt eine Menge Vergnügen, wenn sie richtig angewendet wird. Ihr überlegt wie eure Webseite aussehen soll? Dreht den Spieß doch um: Überlegt doch mal, wie sie nicht aussehen soll!

