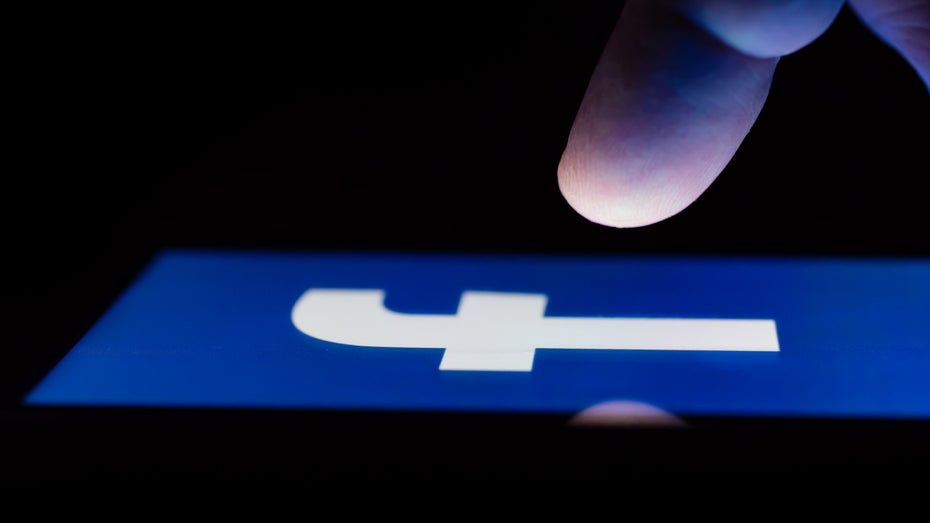
Bringt das BGH-Urteil zur Klarnamenpflicht auf Facebook Licht ins Dunkel? (Bild: Shutterstock /klevo)
Facebook-Nutzer müssen nicht unter ihrem eigenen Namen schreiben, das hat der Bundesgerichtshof am Donnerstag letztinstanzlich entschieden. Die Forderung Facebooks nach der Verwendung des Klarnamens sei unwirksam, so der dritte Zivilsenat am Donnerstag in Karlsruhe (Az. III ZR 3/21 u.a.). Nun muss also Facebook – zumindest auf diesen alten Fall mit damaliger Gesetzeslage bezogen – hinnehmen, dass langjährig angemeldete Nutzer Pseudonyme auf der Plattform gebrauchen.
Das Urteil überrascht nicht. Der Richter am Bundesgerichtshof hatte bereits in der Verhandlung deutlich gemacht, dass man den Passus innerhalb der Facebook-AGB für unwirksam halte, wonach Facebook die Nutzung des Klarnamens verlangen kann. Doch der Fall, um den es hier ging, geht zurück bis ins Jahr 2008. Damals waren die beiden Kläger:innen, ein Ehepaar, der Aufforderung Facebooks nicht nachgekommen, ihre Klarnamen zu verwenden – Facebook hatte daraufhin die Konten gesperrt. Das Oberlandesgericht München hatte dazu noch 2018 geurteilt, Facebook sei hier im Recht – eine Auffassung, der sich der Bundesgerichtshof so nun nicht anschließen konnte.
Kein Freibrief für Pöbeln aus der Anonymität heraus
Uneins sind sich also nicht nur die Gerichte, sondern auch die Social-Media- und Kommunikationsexpert:innen. Denn das BGH-Urteil ist mit viel Für und Wider behaftet. Zum einen gibt es zwar gerade in jüngster Zeit bei Facebook, aber auch bei Twitter und anderen sozialen Netzwerken immer mehr Pseudonyme, weil Kommentator:innen aus der Anonymität heraus Inhalte posten, die bestenfalls gehässig, schlimmstenfalls strafrechtlich relevant sind. Daher argumentierten Netzpolitiker:innen in der Vergangenheit oftmals, die Verpflichtung zur Verwendung des echten Namens sei geeignet, Nutzer von einem rechtswidrigen Verhalten im Internet abzuhalten.
Zum anderen ist aber auch nicht gesagt, dass eine Vor- und Nachnamenkombination wirklich echt ist, insbesondere, wenn nicht flächendeckend bei der Anmeldung der Ausweis verlangt wird. In der Vergangenheit hat sich Facebook hier, wenn überhaupt, nur auf Nachfrage Ausweisdokumente zeigen lassen. Und so wird es gegebenenfalls weiterhin Möglichkeiten des Verschleierns geben, insbesondere dann, wenn Anonymisierungs-Tools hinzukommen. Doch soweit geht es oftmals gar nicht, wie Fälle der Vergangenheit zeigen, in denen es für die Strafermittlungsbehörden durchaus möglich war, Urheber volksverhetzender oder beleidigender Inhalte zu ermitteln.
Entscheidung zugunsten der informationellen Selbstbestimmung
Nachvollziehbar ist aber das Bedürfnis vieler Nutzer nach informationeller Selbstbestimmung und Schutz der eigenen Person – und das deutsche Telemediengesetz verpflichtet Anbieter, die Nutzung ihrer Dienste „anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist“. Die Möglichkeit, ein Pseudonym zu nutzen, so die Befürworter, sichere den Schutz im Netz für all jene, die unbequeme Meinungen äußern wollen und ein berechtigtes Interesse daran haben, nicht zu einer Aussage zugeordnet zu werden. Eine Untersuchung der Uni Zürich hat ergeben, dass gerade Hasskommentatoren dies sogar oft unter dem eigenen Namen tun und hier sogar aggressiver kommentieren, um dadurch beliebter und glaubwürdiger zu wirken.
Hinzu kommt das Argument der Datensparsamkeit, auch wenn die sich hier aufdrängende DSGVO gerade dazu keine konkrete Regelung vorgibt. Erfasst werden sollten nur jene Daten, die unbedingt erforderlich für die Nutzung sind, was bei einem sozialen Netzwerk eben gerade nicht zwingend der echte Name sein muss, zumal ein angegebener Name im Streitfall ohne zusätzliche Beweissicherung gerade nicht ausreicht, um einer Person eine bestimmte Aussage zweifelsfrei zuzuordnen.
Keineswegs mehr Rechtssicherheit durch das Urteil
Das Urteil erfolgt daher in der getroffenen Form im Sinne der Bürgerrechte und der informationellen Selbstbestimmung – und sollte den Betreibern sozialer Netzwerke aber dennoch aufzeigen, dass sie zumindest für jene Altfälle andere Wege finden müssen, für gesetzeskonformen Umgang auf ihrer Plattform zu sorgen.
Ist das Thema damit komplett juristisch abgedeckt? Wohl nicht. Denn verallgemeinern und auf die heutige Zeit übertragen lässt sich all das nicht, wie der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann erklärt, zumal heute nicht mehr §13 des Telemediengesetzes, sondern das seit Dezember geltende TTDSG Anwendung finden wird. „Es wird auch künftig stets eine Abwägung im Einzelfall vorzunehmen sein“, glaubt auch Datenschutzanwalt Thorsten Ihler, Partner der Kanzlei Fieldfisher. „So könnten in anders gelagerten Konstellationen die Rechte der anderen Nutzer und der Plattform überwiegen. Es wird spannend sein zu sehen, wie die Gerichte die Grundrechtspositionen von Plattform und Nutzern im Einklang mit DSGVO und TTDSG bewerten werden.“
Für die aktuelle Situation und neu auftretende Fälle dieser Art könnte daher das OLG-Urteil und die damit verbundene Rechtsauffassung durchaus Bestand haben, das Facebook das Recht einräumt, den Klarnamen zu verlangen. Doch dass Facebook dies von sich aus flächendeckend und bei allen Nutzer:innen tun wird, ist unwahrscheinlich. In Zukunft wird man also vor Gericht streiten müssen, wie zumutbar oder technisch möglich die Anonymisierung oder Pseudonymisierung seitens des Netzwerkbetreibers ist – oder, wie Juristen gerne sagen: „Es kommt drauf an.“

