Von Tencent bis Tiktok: China Inside
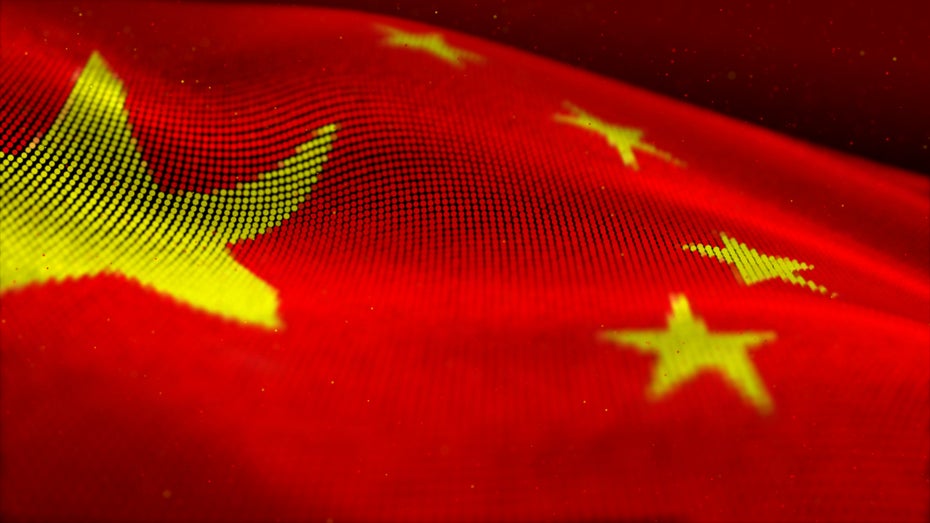
(Abbildung: Shutterstock / muhammadtoqeer)
Doris Fischer hat zwei Handys. „Eins für China und eins für Deutschland“, erklärt die Professorin am Lehrstuhl für China Business and Economics an der Universität Würzburg. Auf Forschungsreisen ins volldigitalisierte China muss sie so nicht ständig die Simkarten wechseln. Und ohnehin: Viele der gängigen Apps lassen sich dort sowieso nicht nutzen. Fischer hat Whatsapp und Instagram auf dem einen und den Messenger-Dienst Wechat und den Payment-Anbieter Alipay auf dem anderen Smartphone installiert: „Mit der Spaltung des Internets lebe ich täglich“, sagt sie. „The great Firewall“, die Abschirmung von Chinas Internet gegenüber ausgewählten Diensten aus dem Rest der Welt, steht nach wie vor. Aber in die andere Richtung ist sie durchlässig.
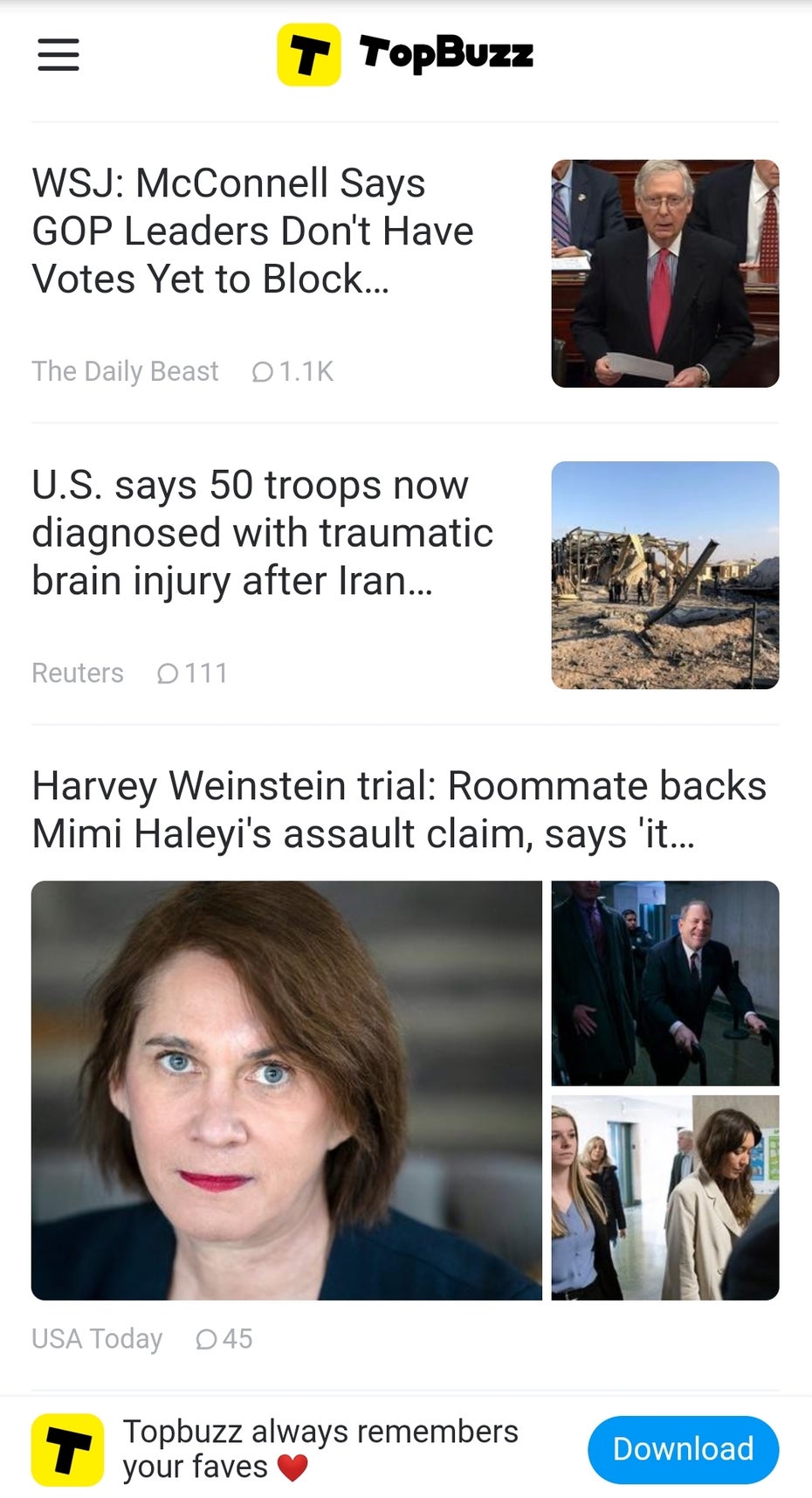
Neben Tiktok ist auch die Nachrichtenplattform Toutiao als „Topbuzz“ in den USA angekommen. (Screenshot: Topbuzz)
Als die Video-App Tiktok im vergangenen Jahr durch die Decke ging und Newsseiten wie Digiday von mehr als vier Millionen Nutzern in Deutschland berichteten, war Doris Fischer im Gegensatz zu vielen Kommentatoren nicht überrascht. „How Bytedance became the first Chinese Tech-Giant to break the West”, betitelte der britische Telegraph einen Text über Tiktoks Mutterkonzern. Für Fischer verbergen sich hinter derlei Formulierungen nichts als „Schranken im Kopf“.
Denn chinesische Firmen sind längst nicht mehr nur die Werkbank der Welt für allerlei Hardware, sondern sie investieren in Cloud-Systeme, künstliche Intelligenz, digitale Gesichtserkennung, Big Data und Smart Cities. Jedes dritte „Einhorn“ der Welt, jene Privatunternehmen, die mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet werden, sitzt heute in China. „Sie haben in China einen großen Markt, in dem sie arbeiten und ihre Algorithmen trainieren, bis sie schlau genug sind“, sagt Fischer, „dann arbeiten sie international.“
Europa wird dabei zunehmend zum Schauplatz der chinesischen Marktoffensive. Schon heute mischt der E-Commerce-Riese Alibaba im Firmenkundengeschäft mit, zieht millionenschwere Logistikzentren hoch und hat in Spanien einen Aliexpress-Store eröffnet. Deepblue, ein Spezialist für künstliche Intelligenz, bringt Labs in einem luxemburgischen Fintech-Hub an den Start, während Tencent nicht nur in Games, sondern auch Milliarden in das Geschäft mit der Cloud oder dem autonomen Fahren investiert. Wird das 21. Jahrhundert ein chinesisches Jahrhundert?
Im Zeitraum von Januar bis November 2019 hatten weltweit 614 Millionen Menschen Tiktok heruntergeladen –, mehr als Facebook. Nur Whatsapp und Messenger waren beliebter, haben die auf den App-Markt spezialisierten Datenanalysten von Sensor Tower ermittelt.
Bytedance und der Culture-Clash
Dabei ist es gerade einmal acht Jahre her, dass der damals 28-jährige Zhang Yiming die Mutterfirma Bytedance in Peking gegründet hat. Er kaufte die Videoplattform Musical.ly und machte aus dem chinesischen Douyin die globale Trend-App Tiktok.
Das Unternehmen setzt konsequent auf mobile Endgeräte und künstliche Intelligenz. Mit seinen content-basierten Empfehlungsalgorithmen machte es den chinesischen Internetgiganten schnell viele Nutzer abspenstig. Neben Tiktok ist auch der News-Aggregator Toutiao so erfolgreich, dass er jetzt unter dem Namen „Topbuzz“ auch westliche Märkte erobert. Bis jetzt sind aber viele der Bytedance-Produkte nur in China verfügbar – wie die englische Lernplattform Gogokid und das Smartphone Jianguo. Der potenzielle Spotify-Herausforderer Resso hingegen, ein kostenpflichtiger Streamingdienst, ist in Indien und Indonesien bereits im Betatest.
Das Bytedance-Zugpferd Tiktok erlebt gerade aber eine Zerreißprobe: die des Ausgleichs zwischen den Interessen im chinesischen Heimatland – und dem Wunsch nach Meinungsfreiheit in den Zielmärkten im Westen. Englischsprachige Medien berichteten im vergangenen Herbst darüber, wie Tiktok systematisch die Verbreitung unliebsamer politischer Inhalte unterbunden hatte – darunter Proteste und Videos über tibetische und taiwanische Unabhängigkeitsbewegungen. Die deutsche Nachrichtenseite netzpolitik.org hatte durch eine anonyme Quelle Einsicht in die Moderationsregeln von Tiktok erhalten und berichtete, dass auch Videos von Menschen mit Behinderungen systematisch im Feed versteckt wurden.
Tiktok-Sprecherin Gudrun Herrmann weist die Vorwürfe zurück. Bereits im Mai habe Tiktok mit der Überarbeitung der umstrittenen Moderationsregeln begonnen, auf deren Grundlage Algorithmen und Angestellte fragwürdige Inhalte löschten oder daran hindern sollten, viral zu gehen: „Da haben wir schon verstanden, dass wir eine Herangehensweise hatten, die ein bisschen mit dem Holzhammer daherkam.“
In einer E-Mail schiebt das Kommunikationsteam hinterher: „Tiktok entfernt oder schränkt keine Inhalte aufgrund ihrer politischen Ausrichtung ein. Wir sind von der chinesischen Regierung nie dazu aufgefordert worden, Inhalte zu entfernen oder einzuschränken und würden dies auch nicht tun, wenn wir dazu aufgefordert würden.“ Auch China-Kennerin Doris Fischer von der Uni Würzburg hat die Diskussion verfolgt. Sie glaubt, dass chinesische Firmen nicht unbedingt auf Druck des Staates agieren, sondern sich selbst zensieren: „Das könnte vorauseilender Gehorsam gegenüber der chinesischen Regierung sein, weil die Unternehmen nicht wollen, dass man ihnen auf die Finger klopft.“
Die Verantwortlichen bei Tiktok in Europa jedenfalls haben Konsequenzen gezogen. In Dublin will das Unternehmen einen neuen Standort eröffnen. Leiten soll ihn Cormac Keenan als „Head of Trust“. Er hatte zuvor eine ähnliche Aufgabe bei Facebook.
„Von Huawei dürfte man gelernt haben, dass eine zu sehr chinesisch wirkende Marke negativ ausgelegt werden kann.“
Und überhaupt: Auffällig oft wird bei den europäischen Tiktok-Ablegern betont, wie wenig sie doch mit dem Mutterkonzern Bytedance und Douyin zu tun haben. „Tiktok und Douyin haben getrennte, voneinander unabhängige Teams, die das jeweilige Produkt managen“, schreibt eine Bytedance-Sprecherin. Das Headquarter von Tiktok sei in Kalifornien – und die Server nicht auf dem chinesischen Festland. Doris Fischer sagt dazu: „Was sie da versuchen zu erzählen, ist schlau. Denn von Huawei dürften sie gelernt haben, dass eine zu sehr chinesisch wirkende Marke negativ ausgelegt wird.“
Huawei und die Politik
Dass Huawei im Bereich der digitalen Infrastruktur weltweit einer der wichtigen Player ist, wurde vor allem im Rahmen der Diskussion um den 5G-Ausbau bekannt. Und auch hier spielt Software eine entscheidende Rolle. Erst im Oktober vergangenen Jahres warnte die Europäische Kommission davor, dass die Software von 5G-Netzen anfällig für Cyberangriffe sei: „5G-Netze sind das künftige Rückgrat unserer zunehmend digitalisierten Volkswirtschaften und Gesellschaften“, schreiben sie. „Unter den verschiedenen potenziellen Bedrohungen gehen die größten Gefahren von Nicht-EU-Staaten oder von staatlich unterstützten Organisationen aus, die zudem höchstwahrscheinlich 5G-Netze ins Visier nehmen werden“, heißt es. Ist damit Huawei gemeint?
„Wir nehmen die Skepsis wahr“, sagt Michael Lemke, Senior Technology Expert bei Huawei. „Intern sind wir traurig und enttäuscht darüber. Wir haben einen cleanen Track-Record, und nicht einer unserer Kunden hat das, was uns vorgeworfen wird, belegt.“ Der Technologieexperte bei Huawei sieht die Probleme daher nicht im hauseigenen Firmenkundengeschäft, sondern bei Politikern, die dem Ruf von Huawei schadeten. Das strahle auch auf den Markt mit den Endkunden aus. Besonders mit dem Angebot von Cloud-Diensten hätten sie es in Europa schwer.
Mit den USA eskaliert der Konflikt bereits. Huawei verstoße gegen die amerikanischen Iran-Sanktionen, so der Vorwurf aus Washington. Deshalb könne auch Firmen wie Google die Kooperation mit Huawei untersagt werden, solange keine Sonderlizenz der US-Regierung vorliege. Huawei fürchtet jetzt um das Geschäft mit den Smartphones, auf denen Googles Android OS läuft. Mit „Stolz“ nennt Lemke „Huawei einen der größten Einzelbeiträger“ für die Weiterentwicklung des Open-Source-Betriebssystems. Noch ist ungewiss, wie weit die Zusammenarbeit zwischen Huawei und Google eingeschränkt werden könnte. Möglicherweise wären auch nur Dienste wie Google Maps, Gmail und die Suchmaschine für Huawei tabu.
Vielleicht wird der Streit eines Tages als eine ironische Wendung im Kampf der Techgiganten interpretiert werden. Langfristig könnte der Konflikt Huawei nämlich nicht nur schaden. Er könnte ihm sogar Auftrieb bei der Softwareentwicklung geben. Im August vergangenen Jahres stellte Huawei ein eigenes Betriebssystem vor, mal bekannt als Harmony, Hongmeng und Ark. Die Vision ist verlockend: Wie bei Apple könnte das Betriebssystem nicht nur auf Smartphones, sondern auch für Fernseher, Laptops und verschiedene Smart Devices ausgespielt werden. Ein Schritt, um sich unabhängig von US-amerikanischen Unternehmen zu machen?
Michael Lemke von Huawei spielt die Bestrebungen für ein eigenständiges mobiles OS herunter: „Da gab es schon immer Konzepte und Überlegungen.“ Er will den Launch nicht allein auf den Handelskrieg zurückführen. „Fakt ist auch der Abstand von solchen Betriebssystemen zu so einem mächtigen, wie es Android ist. Das lässt sich nicht mit einem Fingerschnipp aufholen. Aus einem Betriebssystem wird nichts, wenn es nicht auch das zugehörige Ökosystem mit Applikationen gibt“, sagt er.
Tencent und der Games-Markt
Eher im Hintergrund und kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen, arbeitet ein chinesisches Unternehmen schon länger an einem eigenen Ökosystem: Tencent. Anfangs war das Unternehmen aus Shenzhen nur im Heimatmarkt erfolgreich – mit dem populären Messenger-Dienst Wechat. Der Konzern hat sich jedoch systematisch eine mächtige Position in der globalen Games-Branche erkämpft und kontrolliert heute Plattformen und Anwendungen gleichermaßen.
Zu Beginn mangelte es Tencent an der Expertise in der Sparte. Nach und nach kaufte sich das Unternehmen daher in Entwicklerstudios ein: 2009 investierte der Konzern in Riot Games aus den USA, mittlerweile ist das Studio ein Tochteruntrnehmen der Chinesen. Riot ist bekannt für „League of Legends“ – einem der meistgespielten Online-Spiele der vergangenen Dekade. Ein Jahr darauf folgte der Einstieg bei Epic Games, der Entwicklerfirma hinter „Fortnite“, die 2018 laut einem Bericht von Techcrunch drei Milliarden US-Dollar umsetzte. Aus dem Epic Games Store soll jetzt die wichtigste Plattform für den Vertrieb von PC-Spiele werden – mit zum Teil radikalen Methoden.
Darauf folgten Investitionen unter anderem in das finnische Studio Supercell, das hinter den sehr erfolgreichen Mobile-Spielen „Clash of Clans“, „Clash Royale“ und „Brawl Stars“ steckt. Auch Lutz Anderie, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt University of Applied Sciences, war baff: „Da ist uns in der Games-Branche klar geworden: Hier kommen die Chinesen und sie kommen mit Nachdruck.“
Lange setzte die Branche auf kostenpflichtige Premium-Games. Darunter vor allem US-amerikanische Firmen wie Electronic Arts, Activision Blizzard oder das französische Entwicklerstudio Ubisoft. „Deren Business-Modell wird disrupted“, stellt Games-Experte Anderie fest. „In Sachen Vermarktung hecheln sie Tencent hinterher.“ Das Geschäft mit den Premium-Games schrumpft, im vergangenen Jahr um fünf Prozent in einem globalen Markt von nunmehr 18,9 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit Free-to-play-Spielen hingegen wuchs um sechs Prozent auf 87,1 Milliarden Dollar, wie es der Branchendienst Superdata beziffert.
Laut dem deutschen Branchenverband „game“ machen die Hersteller 45 Prozent des Umsatzes mit In-Game-Käufen Tendenz steigend. Fortnite beispielsweise kann jeder grundsätzlich umsonst spielen. Wer jedoch fancy Outfits oder besondere Waffen möchte, zahlt Kleinstbeträge für die Freischaltung. „Dahinter stehen selbstlernende Algorithmen, die aufgrund des Spiel- und des Kaufverhaltens entscheiden, welches Item wann und zu welchem Preis angeboten wird“, sagt Anderie. „Diese Art der Monetarisierung ist highly sophisticated. Nur ganz wenige Unternehmen haben das Know-how für so eine KI. Und Tencent ist eines davon.“
Dabei profitiert der Konzern von seiner Größe und dem weiten Firmengeflecht mit Social-Media- und E-Commerce-Diensten. „Das strotzt nur so von Synergien“, sagt Anderie. Tencent verschafft sich dadurch ungeheure Datenmengen innerhalb eines Staatskapitalismus, der einen laschen Umgang mit personenbezogenen Daten pflegt. „Mit Blick auf Big Data, Data Mining und Data Cluster ist das natürlich eine traumhafte Spielwiese“, sagt Anderie. Wenngleich er die ethischen Bedenken betont.
„Firmen wie Amazon, Google und Youtube haben im Bereich KI die Nase vorn“, sagt Anderie. „Aber bei dem Aufholtempo könnten die chinesischen Firmen Kalifornien bald schlagen.“ Zahlen unterstützen seine These: Im Jahr 2018 hat China im Bereich KI 30.000 Patente angemeldet – zweieinhalbmal so viele wie die USA. Während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für das ganze Land einen Entwicklungsfonds von 1,5 Milliarden Euro auflegt, macht Xi Jinping mal eben 13,5 Milliarden Euro allein für die AI-Forschung der Stadt Tianjing locker.
Was Tencents Games-Sparte entwickelt, das wird auch auf andere Industrien ausstrahlen. „Die Games-Branche ist der digitale Frontrunner für viele Technologien“, erklärt Anderie und zählt Beispiele auf – wie den Input von Racing-Games auf das autonome Fahren oder Augmented Reality.
Während Tiktok im Kommunikationsbereich und Huawei in Sachen Infrastruktur und Sicherheit zum Teil auf heftigen Widerstand stoßen, agiert Tencent in der Gaming-Industrie nahezu unbehelligt, vielleicht auch deshalb, weil Entertainment politisch nicht als heikel eingeschätzt wird. Unabhängig davon zeigt sich: China ist längst im digitalen Westen angekommen und baut seine Marktmacht immer weiter aus – über enorme Investitionen in neue Technologien wie künstliche Intelligenz, einen nahezu unbegrenzten Zugriff auf Daten, kluge Zukäufe und Übernahmen. Tiktok ist nur die Spitze des Eisbergs.
Zum Weiterlesen:

