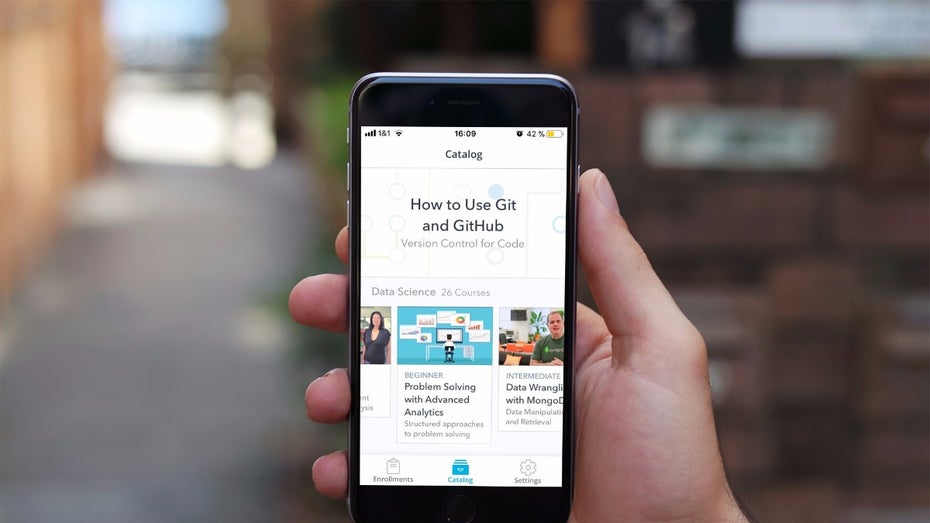(Foto: Shutterstock)
Dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt gehaltstechnisch strukturell benachteiligt sind, ist weithin bekannt. Der Begriff des Gender Pay Gap (GPG) bezeichnet die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern und seine tatsächliche Höhe wird teils kontrovers diskutiert. Der unbereinigte GPG des Bundesamtes für Statistik kommt auf 21 Prozent Lohnunterschied zwischen Frau und Mann, der bereinigte Wert geht von sechs Prozent aus. Ein Grund, warum weibliche Beschäftigte im Verlauf ihres Berufslebens häufig weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, hängt auch mit der Elternschaft zusammen. Es sind vor allem Frauen, die in Elternzeit gehen oder anschließend in Teilzeit arbeiten. Die Bertelsmann-Stiftung hat jetzt die Einkommenseinbußen beziffert.
Ungleichheit im Verdienst ist ungerecht
Wie viel Geld eine Frau aufgrund der Kinderpflege verliert, hängt von der Anzahl der Kinder ab. Das sogenannte Lebenserwerbseinkommen von Müttern liegt demnach deutlich unter dem, was kinderlose Frauen im Laufe ihres Lebens verdienen – ganz zu schweigen von dem, was Väter erhalten. Bei einem Kind beträgt der Rückstand bereits 40 Prozent, bei zwei Kindern sind es 54 Prozent, bei drei Kindern satte 68 Prozent. Kinderlose Frauen haben dagegen ihren Einkommensrückstand auf die Männer verkleinert. Eine Simulationsrechnung hat ergeben, dass kinderlose Frauen, die 1982 in Westdeutschland geboren wurden, bis zur Rente voraussichtlich 1,3 Millionen Euro verdienen werden – und damit fast so viel wie Männer, die auf rund 1,5 Millionen Euro kommen.
Dass diese Ungleichheit im Verdienst nicht nur ungerecht sei, sondern auch mit einer gesamtwirtschaftlichen Ineffizienz einhergehe, kommentieren die Studienführenden. „Wenn Frauen – und insbesondere Mütter – nur rund die Hälfte der für Männer möglichen Lebenserwerbseinkommen erwirtschaften, obwohl sie ihnen in Leistungsfähigkeit und Bildung in nichts nachstehen, wird ein großer Teil des Arbeitskräftepotenzials nicht ausgeschöpft.“ Vor allem der demografische Wandel und der anhaltende Fachkräftemangel seien Grund genug, Mütter stärker in den Arbeitsmarkt einzubinden. Die Optionen reichen von Maßnahmen wie dem kompromisslosen Ausbau der Betreuungsinstitutionen bis hin zu einer Reform des Ehegattensplittings.
1 von 15
Übrigens, auch dieser Beitrag könnte dich interessieren: Frauen sind in der Arbeitswelt noch oft benachteiligt. Antiquierte Rollenbilder und strukturelle Ungerechtigkeiten sind Alltag. Wir haben elf Frauen gefragt, was sich ändern muss. Lies auch: Frauen und Karriere – was sich endlich ändern muss!