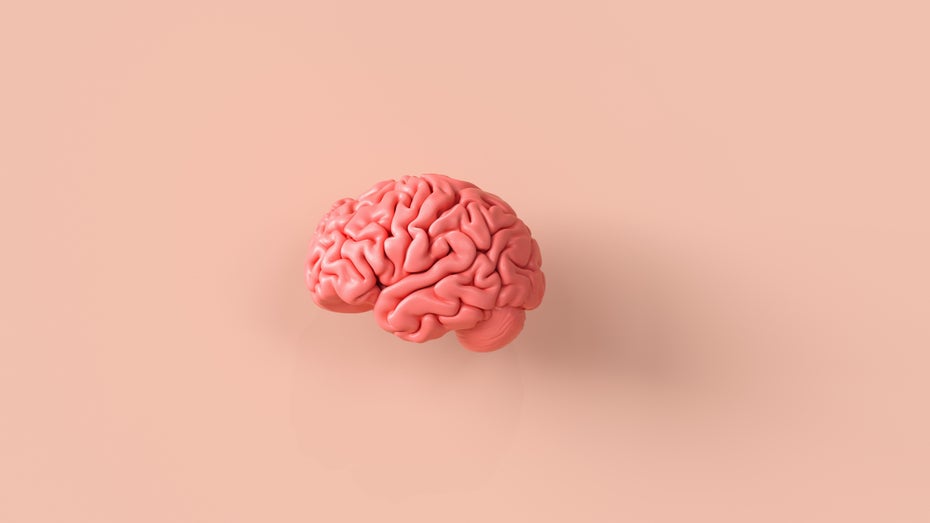
Ist es sinnvoll, sein Gedächtnis an eine KI zu geben? (Foto: Shutterstock / R.Classen)
Die Aufnahme von Informationen aus Online-Medien ist noch begrenzter, als es die Aufnahme von Informationen ohnehin bereits ist. Denn wenn wir ein Buch lesen, helfen Dinge wie Seitenzahlen und die Möglichkeit, die Seiten in der Hand zu halten und umzublättern, unseren Gehirnen dabei, eine mentale Karte der Informationen zu erstellen, die das Buch präsentiert.
An Online-Informationen können wir uns schlechter erinnern
Bei Websites hingegen gibt es diese Art von Gedächtnisauslösern nicht. So konnte schon in mehreren Studien festgestellt werden, dass Offline-Lesende bessere Leistungen in Bezug auf Verständnis, Konzentration und Erinnerungsvermögen erzielten als Online-Lesende.
Erschwerend kommt bei Websites noch die permanente Störbefeuerung unserer Konzentration durch automatisch ablaufende Videos, Werbung und sonstige aufploppende Benachrichtigungen hinzu. Zudem neigen Menschen dazu, Onlinetexte nur zu überfliegen, statt sie durchzulesen. Naheliegend, dass das zu keiner tiefergehenden Erfassung der Informationen führen kann.
So konnten sich über die Jahre Merkzettel-Dienste wie Pocket oder Instapaper etablieren. Dahin lagern wir Links aus, die wir uns später noch einmal in Ruhe ansehen wollen. Meist tun wir es dann aber doch nicht.
Mit dem KI-Gedächtnisassistent Heyday ist eine Software angetreten, unsere Merkfähigkeit zu verbessern. Ganz nebenbei verfolgt Heyday unsere täglichen Online-Aktivitäten und speichert sie. Ein zusätzlicher Aufwand entsteht uns, mit Ausnahme der Erstinstallation der entsprechenden Browser-Erweiterung, nicht.
Selbsttest mit ambivalentem Ausgang
Das klang für den Business-Insider-Journalisten Shubham Agarwal nach einem Deal. Drei Wochen lang testete er die monatlich 19 US-Dollar teure Lösung, die verspricht, keine Nutzerdaten zu verkaufen oder sonst wie anders zu nutzen, als es dem Zweck der Software entspricht.
Das Konzept klingt zunächst gut. Denn die Erweiterung scannt automatisch alles, was wir uns in unserem Browser ansehen – seien es Websites, Google-Dokumente, Notizen, Slack-Konversationen oder Tweets.
Das Gelesene sortiert Heyday dann in Kategorien, die auf dem Thema oder der Zeit basieren, die wir damit verbracht haben. Sobald die Informationen dem Katalog hinzugefügt wurden, werden neben den Suchergebnissen und sogar in Inhalten selbst dynamische Meldungen angezeigt, die darauf hinweisen, dass es dazu bereits gelesene Informationen gibt.
Das überzeugte Agarwal zunächst. Er fand schnell Gefallen an Details der Software, etwa daran, dass Heyday auch Schlüsselwörter unterstreicht, über die er in der Vergangenheit gelesen hatte. Fuhr er dann mit dem Mauszeiger über den Begriff, zeigte die App mehr über das jeweilige Thema an – stets basierend auf dem bereits in der Vergangenheit Gelesenen.
Erstverbesserung entwickelt sich zu Verschlechterung
So hatte Agarwal tatsächlich zunächst das Gefühl, sein Gedächtnis verbessere sich durch die Unterstützung des KI-Tools. Tatsächlich wäre das denkbar. Wer schon einmal Vokabeln gelernt hat, kennt sogar den Mechanismus. Es ist jener der ständigen Wiederholung. Je öfter wir eine Information erhalten, desto besser merken wir sie uns.
Schlussendlich trat bei Agarwal über die Dauer der Nutzung jedoch der gegenteilige Effekt auf. Er begann, sich auf sein Online-Gedächtnis zu verlassen, was sein Erinnerungsvermögen letztlich verschlechterte, anstatt es zu verbessern.
Dennoch will er Heyday weiterhin verwenden. Allerdings eher als Recherche-Tool im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit und weniger als digitales Gedächtnis im Allgemeinen.

