Tim O’Reilly: „Wir steuern auf Peak Digital zu“
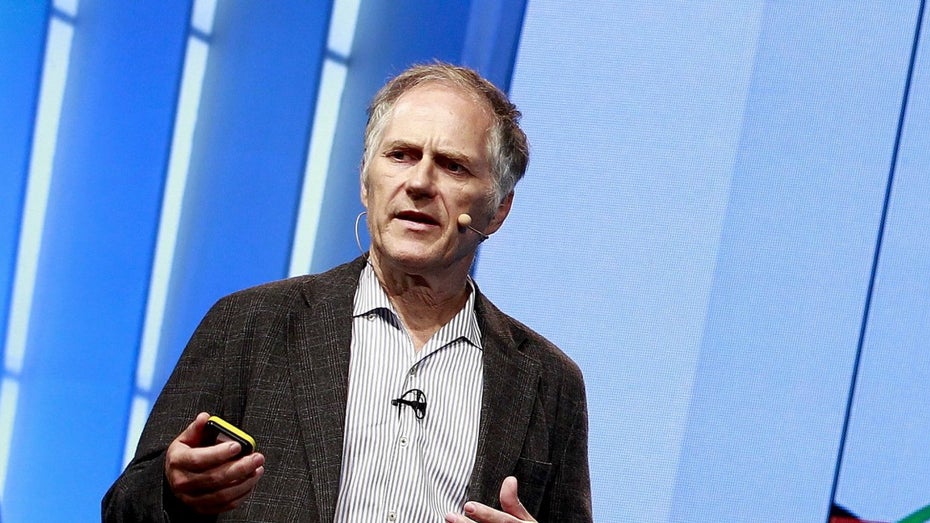
Wie alt ist die digitale Revolution? Laut Tim O’Reilly fast 80 Jahre. Die grundlegenden Arbeiten der Von-Neumann-Architektur veröffentlichte der US-Mathematiker John von Neumann 1945. Bis heute bilden die sie Grundlage moderner Computer.
„Wir steuern auf den Peak Digital zu“, sagte O’Reilly am Freitag auf dem Tech-, Musik- und Film-Festival South by Southwest (SXSW) in Austin. In 100 Jahren könnten die Büros von Google genauso verlassen sein wie heute die Fabrikgebäude, in der die „Spinning Jenny“ steht – die erste industrielle Spinnmaschine aus England.
„So lange der Menschheit die Probleme nicht ausgehen, geht uns auch die Arbeit nicht aus.“
In dieser historischen Perspektive relativiert sich vieles, worüber die digitale Branche derzeit heiß diskutiert – insbesondere die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. O’Reilly glaubt nicht daran, dass künstliche Intelligenz Menschen in absehbarer Zeit arbeitslos machen wird. „Wenn ich mir den Klimawandel, die nötige Erneuerung der Infrastruktur oder die notwendige Pflege der alternden Gesellschaft ansehe, glaube ich nicht, dass uns die Arbeit ausgeht.“
Den US-Investor Nick Hanauer zitiert O’Reilly mit der Aussage „So lange der Menschheit die Probleme nicht ausgehen, geht uns auch die Arbeit nicht aus.“ Dennoch sei er ein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens – es werden nur häufig aus den falschen Gründen befürwortet. Der Chef des O’Reilly-Verlags verweist auf das Beispiel Amazon: Trotz 45.000 neuer Roboter in den Logistik-Zentren des Konzerns seien in dieser Zeit 250.000 Arbeitsplätze bei dem E-Commerce-Riesen entstanden. Was O’Reilly bei dieser Betrachtung allerdings ausblendet: Das Wachstum von Amazon geht auch zulasten von Jobs zum Beispiel bei Einzelhändlern, die in der Regel besser bezahlt waren.
„Wenn uns Technologien unsere Superkräfte sind, dann ist Ungleichheit unser Kryptonit.“
O’Reilly sieht digitale Technologien als positive Kräfte, die Menschen und Unternehmen „Superkräfte“ verleihen und verweist unter anderem auf die Website „Our World in Data“. Der Langfrist-Trend einer ganzen Reihe von Daten von Lebenserwartung bis absoluter Armut sei positiv. Allerdings sieht er auch, dass die Digitalökonomie ein Problem hat: „Wenn uns Technologien unsere Superkräfte sind, dann ist Ungleichheit unser Kryptonit“, sagt er in Anspielung auf das fiktive Mineral aus dem DC-Universum, das Superman Schaden zufügen kann.
O’Reilly sieht Probleme der Ungleichheit in der Digitalwirtschaft
Plattformen müssten für alle Teilnehmer gut funktionieren. Statt dass beispielsweise Uber vor allem darauf optimiert, dass die Kunden oder das Unternehmen gewinnen, müssten auch die Interessen der Fahrer berücksichtigt werden. Dann aber seien solche Plattformen ein wunderbares Netzwerk, von dem alle profitierten. Die Uber-Fahrer seien im besten Sinne des Wortes „augmentierte Arbeiter“, die sich wie die Helden im Film Matrix zusätzlich Wissen einfach herunterladen – nicht wie im Film direkt ins Gehirn, sondern via App auf ihr Smartphone.
Immer dann, wenn nur auf eine einzige Funktion optimiert werde, komme es zu unerwünschten Nebenwirkungen. Ganz so wie Johann Wolfgang von Goethes „Zauberlehrling“, dem ein Zauberspruch seines Meisters entgleist, und der dann lamentierend feststellt: „Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los.“
Als Beispiel führt O’Reilly Facebook an, das – um den Unternehmenswert zu steigern – seine Algorithmen vor allem auf möglichst viele Interaktionen der Nutzer hin optimiert hätte. „Facebook wollte nicht die Gesellschaft spalten – aber das war eine Nebenwirkung der Optimierung nur auf Engagement“, sagt der Open-Source-Vordenker.
O’Reilly: Wir sind Teil der KI
Ähnliche Probleme sieht O’Reilly auch beim Thema künstliche Intelligenz. Tesla-Chef Elon Musk, der in künstliche Intelligenz derzeit die größte Gefahr für eine vollständige Auslöschung der Menschheit sieht, zitiert er mit dem Beispiel einer Erdbeer-Erntemaschine. Diese könnte in Zukunft darauf optimiert werden, so viele Erdbeeren wie möglich in möglichst kurzer Zeit zu ernten – und sich dabei immer weiter selbst verbessern. Irgendwann, so befürchtet Musk in diesem Beispiel, könnte die Maschine als das größte Hindernis der Erdbeer-Ernte den Menschen selbst identifizieren. Wie viele Erdbeeren könnte die Maschine ernten, wenn der Mensch nicht überall siedeln und so wertvollen Platz wegnehmen würde? Eine allein auf Erdbeer-Ernte optimierte Maschine könnten in diesem ursprünglich von Philosophen Nick Bostrom popularisierten Gedankenexperiment den Menschen also letztlich auslöschen.
Allerdings sieht O’Reilly auch hier das Problem weniger in der Technologie an sich als vielmehr im Menschen, der die Regeln aufstellt – und mit der KI interagiert. „Wir sind Teil der KI. Ihr seid Teil der Applikationen von Google bis Facebook. Die kommenden selbstfahrenden Autos sind nicht autonom, sie lernen von uns – und wir lernen von ihnen.“
Letztlich stellt O’Reilly damit die Frage nach der Ethik: Die Optimierung von Unternehmen im Finanzmarktkapitalismus auf die alleinige Steigerung des Gewinns führe ebenso in die Irre wie die Optimierung der Maschine auf das Pflücken von Erdbeeren. Statt nur auf Gewinn müssten Unternehmen zunehmend auch darauf optimieren, wie sie der Gesellschaft nützlich sein können. „Wir brauchen mehr Anreize für mehr Gerechtigkeit und dafür, die Produktivitätsgewinne besser zu verteilen“, sagt O’Reilly. „Es ist unser Job herauszufinden, wie wir die Welt zu einem gerechteren und schöneren Ort für alle machen können.“
Mehr zum dem Thema schreib Tim O’Reilly in seinem aktuellen Buch „WTF?: What’s the Future and Why It’s Up to Us.“


Wenn man da einen Anfang finden will, wäre vielleicht 1936/37 richtiger, als Alan Turings grundlegender Aufsatz „On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem“ erschienen ist. Von Neumanns Stack-Architektur war dann nur noch ein (zugegebenermaßen ziemlich praktischer) Spezialfall.