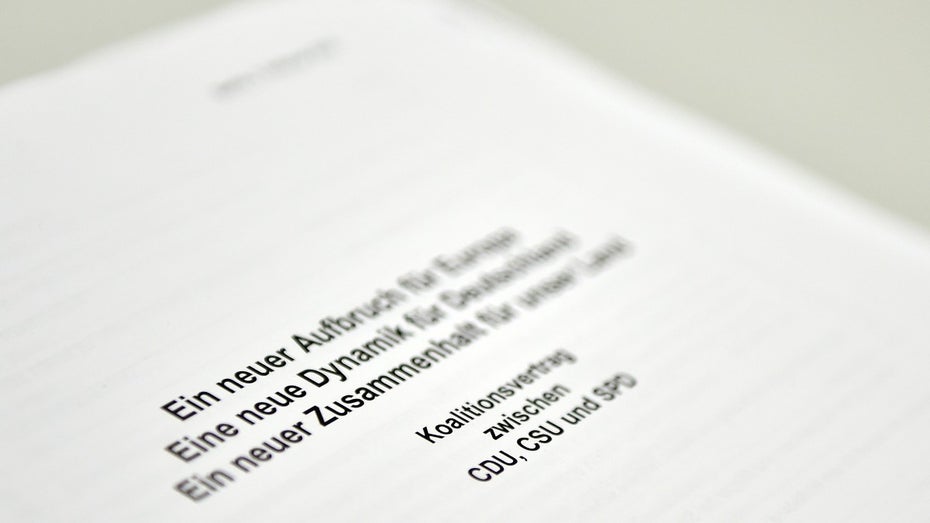
Don't hurt me: Wie die Groko im Koalitionsvertrag auf 170 Seiten niemandem wehtun will. (Foto: dpa)
Mehr als 8.300 Zeilen auf 177 Seiten lang ist der Koalitionsvertrag – und in vielerlei Hinsicht lesenswert. Denn auch wenn es sich bei Koalitionsvereinbarungen naturgemäß nur um Absichtserklärungen handelt, die schon in der Vergangenheit für die beteiligten Parteien nicht in allen Punkten bindend waren, werden sich CDU, CSU und SPD in den kommenden fast vier Jahren an ihren Absichtsbekundungen messen lassen müssen.
Auch wenn in den letzten Tagen vor allen Dingen über die allerletzte Seite, die in knappen Worten die Ressortverteilung zwischen den Parteien regelt, gestritten wurde, sind die über 170 Seiten davor im Hinblick auf die Themen Digitalisierung und digitale Infrastruktur interessant. Fest steht: Ein explizites Digitalministerium wird es auch in dieser Legislaturperiode nicht geben, vielmehr wird die digitale Netzinfrastruktur auch in den nächsten vier Jahren zum Verkehrsministerium dazugehören. Die Entscheidung, Digitalthemen vor allem unter dem Gesichtspunkt der Netzinfrastruktur einzuordnen, ist so kurzsichtig wie das Digitalverständnis der deutschen Parteien in den letzten Jahren. Doch der kommenden Bundesregierung deswegen vorzuwerfen, dass das Digitalthema vollends zu kurz kommt, wäre dagegen auch nicht fair.
Aufbruchstimmung bei der Digitalisierung?
„Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land“, so die blumige Überschrift über dem Koalitionsvertrag. All das ist im Hinblick auf die Digitalisierung zu erahnen. Immerhin, so heißt es gleich in der Präambel, wolle die Bunderegierung „die kreativen Potenziale in Deutschland mobilisieren und die Chancen der Digitalisierung nutzen“. Was man sich darunter vorstellt, wird weiter unten deutlich: Die soziale Marktwirtschaft bedürfe einer Renaissance gerade angesichts der Digitalisierung.
Immerhin fünf Milliarden Euro will die neue Bundesregierung innerhalb der nächsten fünf Jahre für die Stärkung der digitalen Infrastruktur in den Schulen ausgeben sowie für eine gemeinsame Cloud-Lösung und – in der Tat wichtig – für Lehrerfortbildungen im Digitalbereich. Wie man den „Digitalpakt Schule“ konkret ausgestalten will, lässt der Vertrag verständlicherweise offen. Hierzu gab es im vergangenen Jahr jedoch ausführliche Erklärungen, sodass dieser Punkt eigentlich allenfalls eine Fortschreibung des ohnehin durch die letzte Bundesregierung Beschlossenen darstellt. Da sich die Machtverhältnisse nicht geändert haben, war auch nicht zu erwarten, dass die neue große Koalition hieran rütteln würde.
Gute digitale Arbeit: Utopie oder ernsthaftes Bestreben?
Dabei kommt gleich an mehreren Stellen die Absicht zum Ausdruck, die Bevölkerung fit für den digitalen Wandel zu machen: Man wolle in Kooperation mit den Sozialpartnern Fortbildungen im Kontext des „lebenslangen Lernens“ anbieten, um die Bevölkerung auf den digitalen Wandel und mobiles, ortsungebundenes Arbeiten vorzubereiten. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern schließt auch explizit die Medienerziehung älterer Menschen mit ein: „Die Nutzung der digitalen Potenziale ist für ältere Menschen eine wichtige Voraussetzung dafür, möglichst lange aktiv zu bleiben.“
Um „gute digitale Arbeit 4.0“ geht es in einem ganzen Absatz. Der bleibt zwar so vage wie erwartet, lässt aber immerhin die Absicht erkennen, dass die Digitalisierung in Zukunft dazu dienen könnte, Freizeit, Partnerschaft und Familie mit der Arbeitswelt besser unter einen Hut zu bringen – von Zeitsouveränität ist hier die Rede und von der klaren Absicht, zusammen mit den Sozialpartnern dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter eben nicht rund um die Uhr verfügbar sein muss.
Glasfasernetzte und 5G: hier will die Groko Gas geben
Mindestens ebenso wichtig im Zusammenhang mit der Mobilität ist die Infrastrukturfrage: So sollen zehn bis zwölf Milliarden Euro für ein flächendeckendes Gigabit-Netz ausgegeben werden – eine auf den ersten Blick recht konkrete Aussage, die durch die Einschränkung „möglichst direkt bis zum Haus“ allerdings wieder verwässert wird – und die, wie wir wissen, nicht zum ersten Mal als Absichtsbekundung einer Bundesregierung auftaucht.
Spannend ist dabei auch ein Rechtsanspruch, den Bürger auf schnelles Internet haben sollen. Auch wenn erst bis 2025 angestrebt wird, dass Bürger hierauf an ihrem Wohnort ebenso pochen können wie auf die Versorgung mit Wasser und Strom, ist die Frage zum einen, ob die Industrie hierzu verdonnert werden kann – eher unwahrscheinlich – und was wir bis dahin tatsächlich unter schnellem Internet verstehen.
Immerhin bekennt sich die neue Bundesregierung klar zum Auf- und Ausbau eines Glasfasernetzes und will im Bereich der 5G-Netze eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen. Anders als in den USA, wo Donald Trump über ein eigenes regierungsgelenktes 5G-Netz zumindest nachdenkt, soll bei uns die Netzinfrastruktur weiterhin marktgetrieben erfolgen. Und über die Finanzierung des Netzausbaus hat man sich ebenfalls bereits Gedanken gemacht: Die Erlöse der 5G-Lizenzen sollen für die Finanzierung des Netzinfrastrukturausbaus genutzt werden – ein vermeintlich kühner Schachzug, der nahelegt, dass das Ganze aus Steuergesichtspunkten zum Nulltarif erhältlich sei. Auf den Zwischenschritt des Vectoring wird aber auch die neue große Koalition nicht verzichten. Die auf Kupferkabel angewiesene Technik wird weiterhin gefördert, schon um die vorhandene Infrastruktur nicht zu gefährden.
Netzneutralität: Im Prinzip gerne
Nicht unter den Tisch fallen lässt der Koalitionsvertrag das Thema Netzneutralität. Man wolle im Sinne des Verbraucherschutzes einen diskriminierungsfreien Netzzugang sowie die Netzneutralität sicherstellen. Auch wenn gerade im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau durch Partner aus der Wirtschaft hier entsprechende Zweifel bleiben, ist das zumindest eine Aussage, an der man die Bundesregierung messen können wird.
Weniger zuversichtlich muss man beim mobilem Netzausbau sein: Hier werden weiterhin Absprachen zwischen den Netzbetreibern angestrebt. Was im Sinne der Versorgung der Bevölkerung erst einmal positiv und begrüßenswert klingt, wird im Umkehrschluss auch dazu führen, dass die Provider keinen Anlass dafür haben, die im internationalen Vergleich kleinen Datenkontingente zu vergleichsweise hohen Preisen abzuschaffen. Es ist nicht zu erwarten, dass die Mobilfunkanbieter sich ihr lukratives deutsches Geschäft gegenseitig kaputt machen. Hier hätte die Bundesregierung Anlass gehabt, tatsächlich mal Veränderungen im Sinne des Verbrauchers festzuschreiben.
Digital first klingt gut – konkret ist aber anders
Bürgernahe digitale Verwaltung, Forschung im Bereich künstliche Intelligenz und Forcierung der Bestrebungen im Bereich der Industrie 4.0 – all das klingt mit Verlaub nach Buzzword-Bingo und hätte so auch bereits vor vier oder acht Jahren in den Koalitionspapieren stehen können. Die Absicht des „digital first“ im Zusammenhang mit Verwaltungsdienstleistungen vermag sich niemand so wirklich vorzustellen, der in letzter Zeit einmal versucht hat, einfache Verwaltungsakte digital durchzuführen.
Ebenfalls auf dem Schirm haben die Regierungsparteien aber zumindest die „Unterstützung junger, innovativer Unternehmen in der Wachstumspahse“ – über die konkreten und weniger konkreten Absichtserklärungen im Zusammenhang mit Start-ups hatten wir ja bereits geschrieben. An mehreren Stellen betonen die Koalitionspartner, sie wollten den Mittelstand nicht nur finanziell, sondern auch im Hinblick auf die Bürokratie entlasten.
Doch Fonds für Games-Förderung, mehr Open Data – das klingt in der Tat nicht unbedingt nach Themen, die eine Bundesregierung 2018 schon auf der Agenda hat. Man würde gerne mal Politiker unterschiedlicher Parteien spontan fragen, was sie über Open Data wissen. Die Ergebnisse, soviel steht zu befürchten, wären wohl eher ein Fall für die Heute-Show als fürs Heute-Journal.
Spannend sind jedenfalls die Aussagen im Verkehrsbereich: Ein bundesweites E-Ticket als Absichtserklärung (freilich ohne konkrete Roadmap) dürfte allein schon angesichts der zahlreichen Partnerunternehmen und Verkehrsverbünde eine Herausforderung sein, die allenfalls Sisyphus als machbar ansehen wird – und auch die Absicht, digitale Testfelder für autonomes und automatisiertes Fahren auszuweisen, zeigt zumindest, dass die Regierungsparteien die Zukunftsthemen wahrnehmen.
Digitalisierung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht
Halten wir fest: Vieles im neuen Koalitionsvertrag ist so vage wie es zu erwarten war, wenn sich Parteien an einen Tisch setzen, die das ganze Volk repräsentieren und niemandem ernstlich weh tun wollen. Und vieles ist so formuliert, dass in vier Jahren alle Beteiligten sagen können, dass das ja im Prinzip so gekommen ist oder hätte womöglich kommen können.
Betrachtet man den Vertrag kritisch, hat man eher den Eindruck, dass die Digitalisierung (so wie viele andere Themen) auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert wurde – und der ist nun mal nicht revolutionär (im schlimmsten Fall kaum evolutionär). Gleichzeitig sind da doch einige Punkte und Buzzwords, die einzelnen Gruppen gefallen dürften, aber mit entsprechenden Hinweisen auf den rechtlichen Rahmen, der hierfür erst geschaffen werden müsse, relativiert werden. Mit dem Koalitionspapier wurden (so wie mit der großen Koalition an sich) viele Chancen für die nächsten Jahre vergeben, weil selbst die erklärten Ziele allenfalls moderat sind.


Durchaus erwähnenswert sind auch die Absätze zur Blockchain-Thematik im Koalitionsvertrag. Stehen hier doch in diesem Jahr konkret Regulierungsbestrebungen und EU-Richtlinien an. Regeln, auf die nicht zuletzt institutionelle Anwender hoffen, um Bitcoin & Co auch als Finanzinstrument rechtlich sicher etablieren zu können.
Der Satz im Koalitionsvertrag lässt allerdings viel Spielraum. »Um das Potential der Blockchain-Technologie zu erschließen und Missbrauchsmöglichkeiten zu verhindern, wollen wir eine umfassende Blockchain-Strategie entwickeln und uns für einen angemessenen Rechtsrahmen für den Handel mit Kryptowährungen und Token auf europäischer und internationaler Ebene einsetzen«.
Es scheint also keine Blockadehaltung zu geben. Darüber hinaus wird es dann auch regelrecht innovativ und unverbindlich im Koalitionsvertrag zu diesem Thema: »In der Bundesregierung werden wir innovative Technologien wie Distributed Ledger (Blockchain) erproben, so dass basierend auf diesen Erfahrungen ein Rechtsrahmen geschaffen werden kann«.
Die Quintessenz dieser Absichtserklärungen kann man durchaus positiv sehen. Ein Verbot von Kryptowährungen in Deutschland scheint vom Tisch zu sein, wobei eine Regulierung als Schutz vor Geldwäsche in der Agenda steht.
Die Bundesregierung (egal in welcher Koalition) wird sich in diesem Punkt vor allem auf das verlassen, was die BaFin und die Bundesbank raten – und das riecht nach meinem Dafürhalten nach Regulierung und Sicherstellen gewisser Grundregeln. Übrigens fordern dies auch die Banken so ein – und die Haltung der Bundesbank war in dieser Frage „egal ob Bank oder Fintech – alles wird nach den gleichen strengen Regeln behandelt“. Das haben Politiker unterschiedlicher Couleur bereits in der Vergangenheit erklärt und das ist in der Tat auch vernünftig. Ich glaube, ein generelles Unterbinden oder Verbieten von Bitcoin, Ether und Co. steht da gar nicht zur Disposition. Umgekehrt sind aber auch (unabhängig von Kryptowährungen) die Bestrebungen in Sachen Anti-Geldwäsche-Gesetz seit mehreren Jahren europaweit (oder besser eu-weit) klar formuliert.