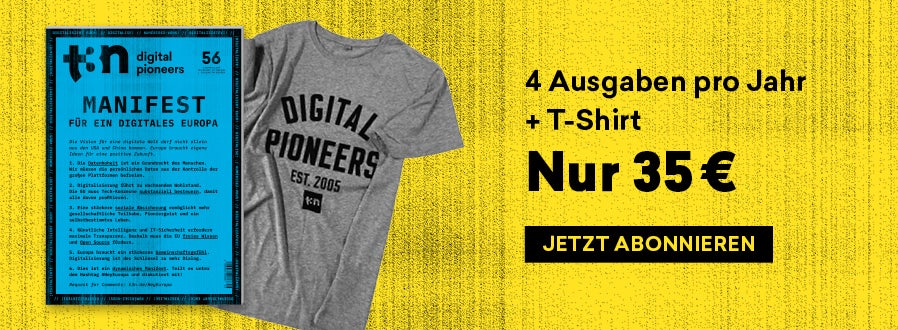Die Linke will sich vor allem für ein soziales Europa einsetzen. (Bild: t3n)
Die Linke verschreibt sich bereits mit der Zielsetzung des Wahlprogramms – „Für ein solidarisches Europa der Millionen, gegen eine Europäische Union der Milionäre“ – einer Politik mit Fokus auf Solidarität und Sozialem.
Europawahl: Die Linke im Digitalcheck
Der Ton ist damit gesetzt: Die Linke will sich für ein soziales Europa einsetzen, „in dem sich nicht große Unternehmen und Reiche vor der Finanzierung des Gemeinwohls drücken können, sondern sich alle an die Regeln einer solidarischen Gemeinschaft halten.“ Dazu braucht es der Partei um ihre Spitzenkandidaten Özlem Demirel und Martin Schirdewan zufolge nicht weniger als einen „Neustart der EU“.
Aber wie startet man eine Ländergemeinschaft wie die Europäische Union neu? Und wie steht die Linke zur Digitalisierung und den verwandten Themen? Wir machen den Check.
„Gerechte Digitalsteuer“
Als Basis zur Finanzierung der Solidargemeinschaft EU sieht die Linke eine einheitliche Digitalsteuer: „Gegen die wachsende Ungleichheit braucht es Steuergerechtigkeit, Kampf gegen Steuerflucht und Steuerdumping, die Finanztransaktionssteuer und eine gerechte Digitalsteuer, die den Internetgiganten ihre Privilegien nimmt.“ Gut und schön – und wie sieht es mit der konkreten Umsetzung aus?
Man will, so formuliert es die Linke, „mit Steuern steuern“. Dabei werden Apple, Google, Amazon und Co. klar in die Verantwortung genommen – gefordert wird ein „EU-weiter Mindeststeuersatz für Unternehmen mit breiten und einheitlichen Bemessungsgrundlagen“, um so auch Steueroasen auszutrocknen. Darüber hinaus sollen Konzerne eine „öffentliche-länderspezifische Berichterstattung“ ablegen, in der sie über Gewinne, bezahlte Steuern, Umsätze und Beschäftigte auf EU-Ebene Rechenschaft ablegen sollen. Zusätzlich soll eine Finanztransaktionssteuer einerseits schädliche Spekulationen an der Börse eindämmen und andererseits zusätzliches Geld in die Kassen spülen.
Dazu sollen „Abschreibungsregeln für immaterielle Vermögenswerte und Steuergutschriften für Forschungsausgaben […] europaweit soweit angeglichen werden, dass Digitalunternehmen Steuern in selber Höhe zahlen wie die anderen Unternehmen.“ Über das Konstrukt der virtuellen Betriebsstätte sollen Profite in den Ländern besteuert werden, in denen die Digitaldienste genutzt werden. Als Zwischenschritt zur einheitlichen Besteuerung fordert die Linke die Bundesregierung auf, die Einführung einer Digitalsteuer nicht weiter zu behindern.
Digitalisierung im Arbeitsmarkt
Wichtig ist der Linken auch, dass die Digitalisierung nicht „auf dem Rücken der Beschäftigten“ stattfindet – man positioniert sich klar gegen eine „digitale Prekarität“ und will insbesondere die Plattformarbeit von Deliveroo und Co. regulieren. Hier geht man sogar noch einen Schritt weiter: „Die Definition von ‚Arbeitnehmer*in‘ und ‚Betrieb‘ muss in Zeiten des digitalen Kapitalismus angepasst und europaweit einheitlich gefasst werden. Für Plattformen, Arbeit in der Cloud oder Crowd und für alle anderen neuen Formen von Betrieben müssen die gleichen Arbeitsstandards und Schutzrechte wie in herkömmlichen Betrieben gelten.“ Umsetzen will die Linke das mithilfe eines „EU-Rahmens“, der außer durch ein paar Schlagworte wie Mindestlohn, Sozialversicherung oder Besteuerung aber nicht weiter konkretisiert wird.
Darüber hinaus schlägt die Linke eine 30-Stunden-Arbeitswoche als Lösungsansatz für Erwerbslosigkeit vor – generell sollen Arbeitnehmer selbstbestimmter entscheiden dürfen, wie viel und von wo aus sie arbeiten wollen. Den Entscheidungsraum für Vollzeitstellen setzt die Partei hier zwischen 22 und 35 Stunden pro Woche an. Was ein bedingungsloses Grundeinkommen angeht, ist man sich bei der Linken nicht einig. Kontrovers werde das Konzept parteiintern diskutiert, aber man unterstütze „Diskussionsinitiativen und Prüfaufträge zum Grundeinkommen auf europäischer Ebene.“
„Digitalisierung von links“
Den bereits erwähnten Neustart in der Digital- und Technologiepolitik sieht die Linke unter dem Credo der Fairness. Dabei soll der „Dreiklang von Netzneutralität, Datenschutz und einem modernen Urheberrecht“ garantiert werden. Digitale Teilhabe und Open Access müssen gesichert werden, um ein „Mehrklassen-Internet“ abzuschaffen. Dabei positioniert sich die Linke klar für Open Source, wenn sie schreibt: „Die öffentlichen Infrastrukturen und Dateninfrastrukturen dürfen nicht an Tech-Konzerne verkauft werden, sondern gehören in die öffentliche Hand.“ Zusätzlich soll das 5G-Netz flächendeckend ausgebaut werden; die Netzneutralität soll dabei durch eine europäische Aufsicht sichergestellt werden. Ein Fonds aus europäischen Mitteln soll zusätzlich dafür sorgen, dass auch ländliche Gebiete am Glasfaser-Internet-Ausbau teilhaben können.
Urheberrechtsreform, Datenschutz und Netzaktivismus
Die Linke stellt sich auf die Seite der Netzaktivisten gegen Uploadfilter – und hat auch dementsprechend im Europaparlament abgestimmt – und setzt sich nach eigenen Angaben „für ein offenes, solidarisches und freies Internet und für solidarische Ökonomien, die auf einem solchen Internet aufbauen können“ ein. Dabei legt man auch einen Fokus auf starken Datenschutz, der erreicht werden soll durch eine Verschärfung der DSGVO mit höheren Strafen und mehr Rechten für Datenschutzbeauftragte. Danach soll in einem zweiten Schritt ein europäisches Datenschutzsystem implementiert werden.
Explizit erwähnt werden auch Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung von Beschäftigten. Dabei sollen Arbeitgeber nur diese Daten speichern dürfen, die notwendig sind, damit Arbeitnehmer ihren Arbeitsvertrag erfüllen können. In logischer Konsequenz will sich die Linke auch dafür stark machen, dass „kritische Öffentlichkeit“ möglich bleibt: Dazu sollen nicht nur Whistleblower geschützt werden, sondern auch die Plattformen, auf denen die kritischen Inhalte veröffentlicht werden können.
Und sonst?
Zum Thema Cybersicherheit will die Linke „Sicherheitszertifikate verbindlich vorschreiben“, mit deren Hilfe Online-Sicherheit, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit gewährleistet werden sollen, sogenannte Staatstrojaner sollen verboten werden.
Begriffe wie „Startup“ oder „Gründer“ sucht man in dem 59 Seiten starken Papier der Linken vergeblich. Zwar hat die Partei im Digital-Thesen-Check des Zentrums für Digitale Wirtschaft D64 angegeben, ein EU-Budget für Startup-Förderung einführen zu wollen. Details oder erläuternde Ausführungen wurden aber nicht gemacht. Ebenso verhält es sich mit der sogenannten Remix-Schranke, mit der beispielsweise Memes im Zuge einer Fair-Use-Regelung rechtlich abgesichert werden sollen. Zusätzlich befürwortet die Linke Ausnahmen im Urheberrecht, wenn es um die Nutzung für Forschung und Lehre geht.
Fazit
Konkrete Vorschläge zur Umsetzung vieler Forderungen findet man im Wahlprogramm der Linken wenig. Eine Ausnahme ist die Digitalsteuer beziehungsweise der Plan, Digitalunternehmen in gleichem Maße wie „normale“ Konzerne zur Kasse zu bitten. Hier lassen sich aus der bisherigen Praxis und den bestehenden Steuersätzen konkrete Zahlen ableiten. Von diesen bisher hypothetischen Mehreinnahmen verspricht sich die Linke dann viel – um damit andere Ziele zu verwirklichen.
Ansonsten bestätigt der Check den Eindruck, dass die Linke sich selbst nicht als dedizierte Partei für digitale Themen sieht. Die Digitalisierung ist eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist und mit der sich alle arrangieren müssen. Dabei kann man sich die Vorteile durchaus zunutze machen – etwa über ein generelles Recht auf Homeoffice –, ansonsten behält die Linke aber soziale und solidarische Themen im Fokus.
Die Europawahlprogramme der Parteien im Überblick
- Europawahlprogramm im Digitalcheck: Was will die FDP?
- Europawahlprogramm im Digitalcheck: Was wollen CDU/CSU?
- Europawahlprogramm im Digitalcheck: Was will das Bündnis 90/Die Grünen?
- Europawahlprogramm im Digitalcheck: Was will die AfD?
Unser neues Heft „Hey Europa“ beschreibt, wie wir eine positive digitale Zukunft für Europa erschaffen können. Dazu haben wir ein Manifest veröffentlicht – beteilige dich hier an der Diskussion!