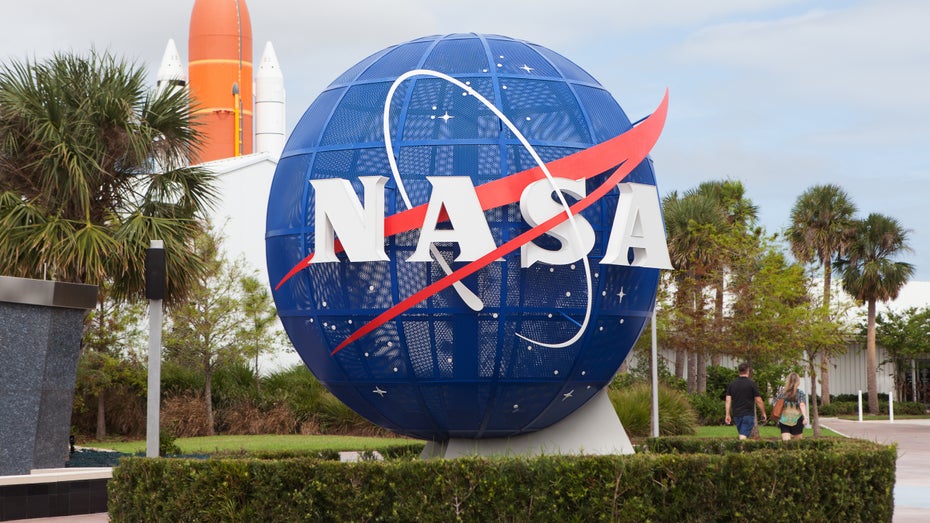
Ausrangierte Satteliten und Raketen entsorgt die Nasa in der Regel im Pazifischen Ozean. (Foto: Shutterstock)
Dasselbe Schicksal, das Anfang 2001 die russische Raumstation Mir ereilte, soll binnen des nächsten Jahrzehnts also auch die ISS einholen: Sie wird ihre letzte Ruhe auf dem Raumschifffriedhof Point Nemo finden. Rund 263 Weltraummüllteile haben die Vereinigten Staaten, Russland, Japan und Europa seit 1971 dort abgeladen. Point Nemo liegt zwischen Neuseeland und Südamerika, in einem Teil des Pazifiks, der sich weit entfernt von menschlichem Lebensraum befindet und zudem innerhalb des Südpazifikwirbels liegt, dessen Strömung die Anzahl der Lebewesen in dieser Region stark beschränkt.
Wieso muss der Ozean als Müllhalde herhalten?
Auch wenn das Vermüllen des Meeres durch Weltraumschrott sicherlich nicht nachhaltig ist, birgt es doch einen großen Vorteil gegenüber der Alternative: Das Versenken von Raumfahrzeugen in einem abgelegenen Teil des Ozeans reduziert die Trümmer im Weltraum. Diese würden sonst wie viele andere ausrangierte Satelliten unbeaufsichtigt in den Tiefen des Weltraums herumtreiben, was im schlimmsten Fall zu Kollisionen mit anderen Satteliten führen könnte, wenn diese in derselben Umlaufbahn treiben.
Nach Angaben der Nasa umkreisen derzeit mehr als 23.000 Trümmerteile, die größer als zehn Zentimeter sind, die Erde. Wenn diese Zahl weiter wächst (was angesichts des immer weiter fortschreitenden technologischen Fortschritts und somit der Zahl der entsendeten Satteliten höchst wahrscheinlich ist), müssen sich Raumfahrtbehörden langfristig jedoch etwas anderes einfallen lassen, um der Masse an Weltraumschrott gerecht zu werden.
Nasa: So kontrolliert sie die Entsorgung von Weltraumschrott
Eine Entsorgung, wie sie der ISS bevorsteht, muss natürlich äußerst kontrolliert erfolgen und erfordert daher präzise Berechnungen der Flugbahn – schließlich wäre es verheerend, wenn der Weltraumschrott nicht am eigentlichen Zielort auf die Erde aufprallt, sondern womöglich Lebewesen oder Bauwerke trifft.
Lottie Williams wurde von einem winzigen Raketenteil getroffen
Tatsächlich ist das höchstwahrscheinlich schon einmal geschehen: Im Jahr 1997 stürzte ein ausgedienter Nasa-Satellit in die Erdatmosphäre, wobei die Chance, jemanden zu treffen, bei 1 zu 3.200 lag. Leider war diese eine Chance Lottie Williams aus Tulsa, Oklahoma, die von einem Teil der Delta-II-Rakete getroffen wurde, als sie durch einen Park spazierte. Verletzungen trug sie nicht davon – das Metall war nur wenige Zentimeter groß. Aber Lottie Williams ging in die Geschichte der Raumfahrt ein. Und das, obwohl die Nasa den Vorfall nie offiziell bestätigte.
Und dennoch kalkulieren Raumfahrtagenturen nun sehr sorgfältig, wo sie ein Raumfahrzeug aus der Umlaufbahn werfen, damit es an der gewünschten Stelle wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Durch die Hitze, die beim Sturz entsteht, wie auch dem Druck, den der Eintritt in die Erdatmosphäre erzeugt, werden die Wrackteile in kleinere Müllstücke zerlegt, die dann ohne größere Gefahr ins Meer fallen können.

