Neuralink und Co: Gehirnimplantate verändern laut Forschern die Persönlichkeit
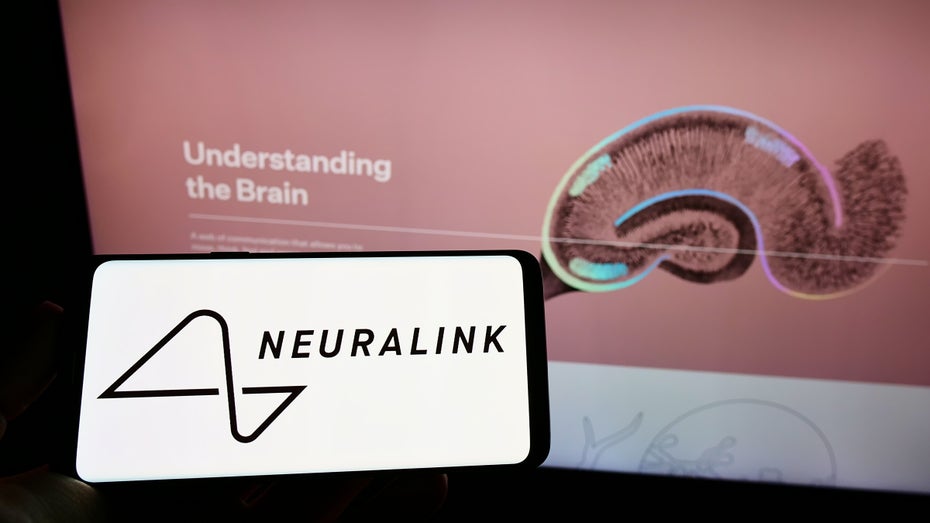
Was nach Science-Fiction klingt, soll laut Elon Musk schon bald möglich sein: Mit den Hirnimplantaten seines Unternehmens Neuralink sollen sich Gelähmte eines Tages wieder bewegen und Erblindete wieder sehen können. Auch Krankheiten wie Parkinson, Demenz oder Alzheimer könnten mit den Chips behandelt werden. Das zumindest verspricht der Milliardär.
Dafür hat er mit Neuralink ein halbes Jahrzehnt damit verbracht, herauszufinden, wie Gehirnsignale in digitale Ausgaben übersetzt werden können. Wie Musk im Dezember letzten Jahres ankündigt hat, sollen die Chips von Neuralink bereits in drei Monaten an Menschen getestet werden. Das Unternehmen des Tesla-Chefs ist aber bei Weitem nicht das einzige, das an Gehirnimplantaten forscht.
Und obwohl die Technologie noch in Kinderschuhen steckt, gibt es sie bereits lange genug, dass die Forschung sich längst auch damit befasst, wie Gehirnimplantate mit unserem Verstand interagieren. Die Studien sind teilweise beängstigend.
Wird Fiktion bald Realität?
In dem Film „The Terminal Man“ von 1974 leidet ein Mann nach einem Unfall an unkontrollierbaren Aggressionsschüben. Er lässt sich deshalb ein invasives Gehirnimplantat einpflanzen, das die Anfälle regulieren soll. Und obwohl der Eingriff zunächst erfolgreich zu sein scheint, geht das Experiment nach hinten los: Der Operierte flieht aus dem Krankenhaus und starten einen nächtlichen Amoklauf.
Könnte dieses Szenario auch in der realen Welt passieren? Schließlich ist das Eingreifen in die Funktionen eines menschlichen Gehirns eine heikle Angelegenheit. Anna Wexler, Assistenzprofessorin für Philosophie am Department of Medical Ethics and Health Policy an der University of Pennsylvania, sagte gegenüber Sciencealert.com: „Natürlich verursacht es Veränderungen. Die Frage ist, welche Art von Veränderungen es verursacht und wie stark sich diese auswirken?“
Implantate geben Menschen ihr Selbstwertgefühl zurück
Wexler hat eine Studie bei Menschen mit Parkinson durchgeführt, die sich einer Tiefenhirnstimulation unterzogen hatten. Dabei handelt es sich um eine medizinische Behandlung, bei der dünne Metalldrähte implantiert werden, die elektrische Impulse an das Gehirn senden, um motorische Symptome zu lindern. Viele der Probanden hatten vor der Behandlung ihr Selbstwertgefühl verloren.
„Viele hatten das Gefühl, dass die Krankheit sie in gewisser Weise ihrer Identität beraubt hatte“, so Wexler gegenüber Sciencealert.com. „Es wirkt sich wirklich auf deine Identität und dein Selbstbewusstsein aus, wenn du die Dinge, von denen du denkst, dass du sie kannst, nicht tun kannst.“ In diesen Fällen gaben die Brain-Computer-Interfaces (BCI) den Menschen das Gefühl, zu sich selbst zurückzufinden, weil sie ihnen dabei helfen, die vorliegende Krankheit zu bekämpfen.
Auch Eran Klein und Sara Goering, Forscher:innen an der University of Washington, haben bei Menschen, die BCI verwenden, positive Veränderungen in der Persönlichkeit und Selbstwahrnehmung festgestellt. In einem Paper vom Jahr 2016 erläutern sie, dass Studienteilnehmer:innen durch die Behandlungen oft das Gefühl hatten, ein „authentisches“ Ich zurückgewinnen zu können, das von Depressionen oder Zwangsstörungen zerstört worden war.
Nicht nur positive Auswirkungen
Doch nicht alle Veränderungen, die Forscher:innen festgestellt haben, sind positiv. Frederic Gilbert, ein Philosophieprofessor an der Universität von Tasmanien, der sich auf angewandte Neuroethik spezialisiert hat, hat bei einigen Menschen, die BCI hatten, Ungewöhnliches bemerkt. „Wir haben Fälle, in denen klar ist, dass BCI Veränderungen in der Persönlichkeit oder im Ausdruck der Sexualität bewirkt haben.“ Patient:innen hätten von Gefühlen berichtet, in denen sie sich selbst nicht wiedererkennen würden.
„Sie wissen, dass sie sie selbst sind, doch es ist anders als vor der Implantation“, erklärt er. Sie hätten das Gefühl, Dinge tun zu können, die sie in gefährliche Situationen bringen könnten. So verletzte sich beispielsweise eine Frau in ihren 50ern, weil sie versucht hat, einen Billardtisch anzuheben. Sie war nämlich der Meinung, sie könnte den Tisch komplett alleine bewegen.
Dem Forscher sind auch Worst-Case-Szenarios bekannt. So hätte es auch extreme Fälle gegeben, in denen es zu Selbstmordversuchen gekommen ist.

