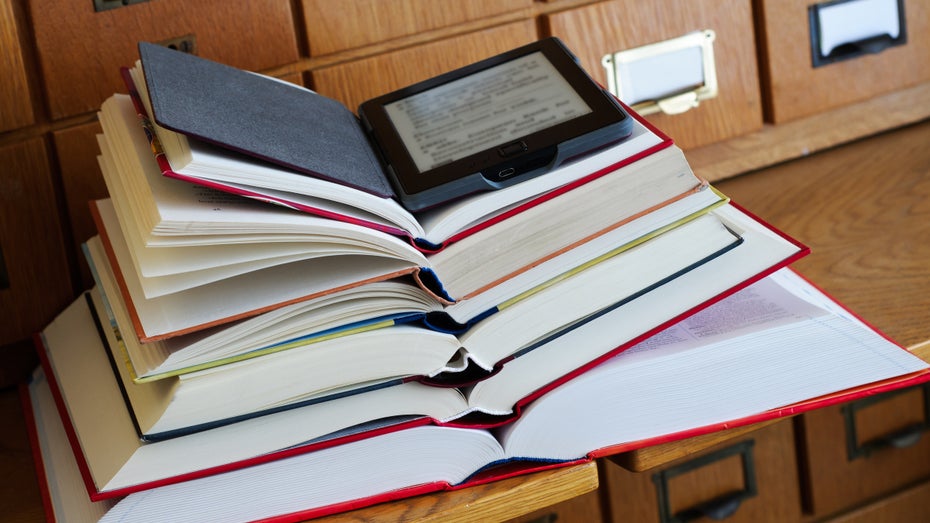
Die deutsche Kulturlandschaft hat ein neues Aufregerthema: Es geht um E-Books, genauer um die Frage, wer diese zu welchen Konditionen in Bibliotheken über das Portal Onleihe ausleihen kann. Frank Schätzing, Juli Zeh, Sven Regener und ursprünglich 190 weitere Autoren und Kulturschaffende (inzwischen deutlich mehr, die den offenen Brief unterzeichnet haben) haben eine Initiative unter dem Claim „Fair Lesen“ begründet, die gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht überraschend kommt und das Recht auf Windowing zur faireren Entlohnung der Autoren einfordert.
Die Autorinnen und Autoren sehen eine deutliche Einschränkung ihrer Rechte, einen Eingriff in die Urheberrechte und einen Eingriff in die Verhandlungs- und Vertragsfreiheit der Verlage. „Inzwischen gibt es immer mehr Menschen, die den Mitgliedsbeitrag der Bibliothek bezahlen und dann unzählige E-Books umsonst lesen“, zitiert die Süddeutsche die Managerin im Delius-Klasing-Verlag, Nadja Kneissler. Eine möglicherweise etwas ungünstige Formulierung, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass Bibliotheken und Stadtbüchereien in der heutigen Form ja genau dazu geschaffen wurden – um Bücher und Kulturgut in die breite Bevölkerung zu tragen, für günstiges Geld und flächendeckend. Möglicherweise würde eine solche Idee heute nicht mehr die Mehrheiten finden, die sie braucht, insofern ist es gut, dass dieses Element der gesellschaftlichen Teilhabe bereits etabliert ist.
Von „Flatrate-Denken“ ist da die Rede und die Onleihe wird in der Diskussion, die die Verleger, Autoren, Bibliotheken und digitalen Dienstleister erbittert führen, in eine Ecke mit Download-Portalen gestellt, bei denen Nutzerinnen und Nutzer Tausende von Dateien einfach so herunterladen können oder wie bei Netflix und Co. stets Zugriff auf jedes Buch, das sie gerade lesen wollen, haben können.
Onleihe-Bücher oft schwierig verfügbar
Die Realität sieht etwas anders aus: Die Bibliotheken erwerben über den Onleihe-Dienstleister die Lizenzen der E-Books, ähnlich wie sie über Buchhandlungen die physischen Bücher erwerben und katalogisieren. Die E-Books können dann jeweils auch nur so viele Nutzer einer Bibliothek ausleihen wie es Exemplare gibt. In der jeweiligen Frist ist das Buch für andere Interessent:innen gesperrt. Also eigentlich ziemlich genau so wie bei herkömmlichen Büchern – mit dem Unterschied, dass sich – das bemängeln die Initiatoren von Fair Lesen noch dazu – das E-Book nicht abnutzt und so langfristig zur Verfügung steht, und dass die Lesenden nicht in die Bibliothek gehen müssen, sondern „vom Sofa aus“ bestellen und lesen können. Doch schon heute werden – das ist auch ein Teil der Wahrheit – die Onleihe-Lizenzen entweder zeitlich oder mengenmäßig beschränkt.
Doch das „all you can read“ erschöpft sich rein inhaltlich ohnehin im eigenen Zeitbudget, zum anderen würde nicht jedes Buch, dass ein Büchereikunde ausleiht, auch gekauft werden. Und noch dazu ist die Verfügbarkeit gerade bei E-Books in den meisten Büchereien mehr als beschränkt: Auf viele gefragte Titel muss man mehrere Monate warten, sodass gerade angesichts dessen mancher Kunde dann doch den Weg in die Buchhandlung seiner Wahl findet, wenn er einen Titel, der erst binnen Wochen zur Verfügung steht, gleich lesen will. So gesehen ist die Onleihe unter Umständen sogar verkaufsfördernd.
Bibliothekstantieme gilt nicht für E-Books
Ein entscheidender Unterschied zwischen den ausleihbaren Büchern und E-Books ist indes die Form der Entlohnung der Autoren und Verlage. Bei physischen Büchern gibt es seit vielen Jahren die Bibliothekstantieme. Die sieht vor, dass für jeden Ausleihprozess – abgesehen von den operativen Kosten, den eine Bibliothek hierfür hat – 4,3 Cent an die VG Wort gehen, die das Geld dann an Autoren (3 Cent) und Verlage (1,3 Cent) verteilt. Ein System, das sich im Prinzip seit vielen Jahren bewährt, aber derzeit nicht die Vergütung der E-Book-Ausleihen vorsieht. Der Schönheitsfehler: Es gilt nicht für die E-Books. Für diese Gattung, die inzwischen immerhin laut einer GfK-Studie vom November 2019 für fast die Hälfte aller E-Book-Nutzungen verantwortlich ist – 46 Prozent der E-Book-Lektüren erfolgt demnach über die Onleihe – gibt’s bislang keine Bibliothekstantieme, was an der Abwicklung über Divibib, einen Dienstleister, der die Onleihe für die Bibliotheken abwickelt, liegt.
Die Onleihe hat im Jahr 2020 rund 45 Millionen Ausleihvorgänge bundesweit zu verzeichnen und ist ein funktionierendes, wenn auch mehr oder weniger gut handhabbares Modell. Die Verleger rechnen vor, dass bei einem Beststeller Verlag und Autor erst nach 33 Ausleihvorgängen den Gegenwert eines gekauften Buchs erhalten. Das trifft natürlich vor allem Autoren, deren Bücher in der Regel nur einmal gelesen und bestenfalls weitergegeben werden, wohingegen Fachbuchautoren ohnehin auf deutlich anderem Niveau über ihre Vergütung jammern könnten.
Komplexe Interessenlage zwischen den Protagonisten
Das hierüber gestritten wird, ist klar und nur verständlich, denn Urheber – also Autoren und Verlage gleichermaßen – müssen einen fairen Anteil an sämtlichen Nutzungsformen erhalten. Und darum wird jetzt gestritten, die Gemengelage und die Zahl der Protagonisten mit teilweise gleichen, teilweise mehr oder weniger divergierenden Interessen sind vielfältig: Die Verlage, die jetzt offenbar auch große Namen unter den Autoren ins Boot geholt haben, kämpfen seit Jahren um etwas, das in der Filmbranche seit vielen Jahren zunehmend schlechter läuft und aufgeweicht wird: Windowing, also das Zurückhalten bestimmter Inhalte, Darreichungsformen, Verwertungsketten. Bestseller, so die Idee, sollen dem ausleihenden Volk erst einmal nicht zur Verfügung stehen, sondern zunächst nur käuflich als E-Book erwerbbar sein. Ein Konzept, das im Buchbereich dagegen wohl nicht durchsetzbar und mehrheitsfähig ist, wie auch Experten aus dem Literaturbetrieb zugeben.
Doch es geht um Geld. Denn die Bibliotheken fordern über ihren Verband von der Politik, dass mit dem unseligen Windowing, analog zum physischen Buch, Schluss gemacht wird und Verlage ihre Neuerscheinungen ausnahmslos auch in die Onleihe geben müssen. Für die Urheber – Verlage wie Bestsellerautoren gleichermaßen, gerade für letztere – ist das natürlich nicht vorteilhaft, weswegen sie jetzt mit bemerkenswert brachialer Argumentation versuchen, das abzuwenden. Von Zwangslizenzen und Einschränkungen in der Vertragsfreiheit sprechen die Verlage.
Im Bundesrat liegt bereits eine Gesetzesinitiative dahingehend, dass die Bibliotheksverbände Gehör gefunden haben. Dass diese in der letzten Legislaturperiode nicht mehr durchging, führt nun dazu, dass die Verleger sich mit der genannten Aktion klar positionieren wollen und das Unheil doch noch abzuwenden versuchen – versehen mit großen Namen.
Ein vernünftiges Vergütungssystem muss her
Doch wie ist das Problem zu lösen: Dass es eine angemessene Vergütung für urheberrechtlich geschütztes Material geben muss, sieht bereits Artikel 11 des Urheberrechts vor. Wie diese aussehen kann, ist auszuhandeln. Doch hier wird es wohl schwierig werden, Bücher nach Premium und Standard zu unterteilen, weswegen es gerade viele große Autor:innen sind, die sich hier positionieren (und manche weniger bekannte, die in den sozialen Medien gegen ein solches Ansinnen sind).
Klar sollte den Verlagen und Autor:innen allerdings sein, dass der Feind weniger in den Bibliotheken sitzt. Denn Barrierefreiheit (physisch wie sozial) ist ein wichtiges Gut, für das das Büchereiwesen steht. Und wenn sich, wie in der GfK-Studie zu lesen und 2020 durch die Pandemie sicher nicht weniger geworden, ein Großteil der E-Book-Nutzung auf Leihprozesse bezieht, müssen die Autoren hieran auch ihren fairen Anteil haben. Die Idee mit der Verwertungskette und dem Wegschließen von Neuerscheinungen sollten sie allerdings bald mal ad acta legen.

