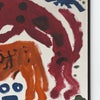Web3-Myth-Busting: Wie fälschungssicher, revolutionär und umweltfreundlich ist es?

Im Internet nennt sich Jürgen Geuter „tante“ und kritisiert die Richtung, in die sich das globale Netz entwickelt. Das Web3 ist für viele Krypto-Enthusiast:innen die Zukunft des Internets. Sie hat aber auch viele Schattenseiten, meint Geuter und berichtet darüber auf seinem Blog und auf Twitter.
Wir haben mit dem Informatiker und freiberuflichen Wissenschaftler darüber gesprochen, welche Gefahren von den Token und Coins ausgeht. Dazu haben wir ihm sechs gängige Annahmen aus der Web3-Welt vorgelesen, zu denen er Stellung bezieht – Myth-Busting.

Jürgen Geuter schreibt im Internet als „tante“ gegen den Betrug bei der vermeintlichen Zukunft des Webs an. (Foto: Michael Kohls)
1. Bitcoin ist digitales Gold.
Ja, Bitcoin ist digitales Gold. Gold ist – wie Bitcoin – ein extrem gehyptes Asset mit einem aufgeblasenen Preis. Die Idee, dass man seine Finanzvorsorge auf Gold aufbauen sollte, ist in der Ökonomie seit Langem überkommen. Bitcoin und Gold bilden also beide überkommene und seit Langem ökonomisch nicht mehr relevante Verständnisse ab. Das System von Bitcoin ist noch dazu technisch nicht mehr up to date.
2. Die Dezentralität bringt Stabilität. Eine Blockchain kann nicht ausfallen und ist von jeder zentralen Gewalt unabhängig.
Ja, Dezentralisierung macht die Datenbanken von Ethereum und Bitcoin robust. Der Vorteil ist, dass, wenn ein Server downgeht, jeder andere Server auch eine Kopie der Daten hat. Die Datenbank verschwindet nie. Aber nein, mehr Teilhabe bringt die Dezentralisierung realistischerweise niemandem.
Das Bitcoin-Mining verbraucht sehr viel Strom und Ressourcen. Die Infrastruktur und die Macht über die Blockchain liegen in der Hand der Miner. Wenn sie sich zusammentun würden, könnten sie die Bitcoin-Transaktionen ändern.
Das ist gar nicht so unrealistisch, denn das Mining von Bitcoin ist nicht so dezentral, wie man denkt. Es gibt viele Miningpools, die aus ökonomischen Gründen zentralisiert sind. Es sind wahrscheinlich nur drei bis vier Hände voll Menschen – Entwickler und Inhaber von Miningpools –, die es bräuchte, um Bitcoin zu kontrollieren. Und diese Menschen kennen sich alle untereinander.
3. Durch Non-Fungible Token (NFT) können Künstler:innen direkt an ihren Werken verdienen. Das demokratisiert den Kunstmarkt.
Diese Aussage ist so falsch, dass nicht mal das Gegenteil richtig ist. Es ist einfach ein absurdes Statement. NFT garantieren einem gar nichts.
Wenn ich Menschen auf der Straße ein Post-it in die Hand gebe, auf dem steht: „Dir gehört die Mona Lisa“, hat das den gleichen Effekt wie ein NFT. Es gibt den Menschen kein Eigentum oder Nutzungsrechte an dem Gemälde. Dieses Narrativ vom NFT-Kunstmarkt verkennt das Copyright-Regime, die Rechte für Künstler:innen, die wir schon etabliert haben.
Klar, können einzelne Künstler und Künstlerinnen mit NFT Geld verdienen. Aber dafür haben wir schon länger andere Infrastrukturen wie zum Beispiel Subscription-Modelle. Die funktionieren sicher nicht für alle Künstler:innen. Aber das tun NFT auch nicht.
Ich verdiene nicht allein dadurch Geld, weil ich ein NFT gemacht habe. Ein Großteil der NFT-Verkäufe ist nur von einer in die andere Tasche gemacht worden, um den Preis für das Token hochzutreiben. Viele Künstler, die NFT herausgebracht haben, um ihre Arbeit zu finanzieren, haben nicht mal so viel eingenommen, wie sie bereits an Gebühren gezahlt hatten.
NFT sind ein spekulatives Asset für eine Handvoll Leute. Sie demokratisieren oder revolutionieren gar nichts. Theoretisch gibt es NFT, die einem ein Copyright geben können, wie vom Bored Ape Yacht Club. Aber die Rechte, die den Käufer:innen versprochen werden, stehen auf der Website vom BAYC, nicht im NFT. Wenn Yuga Labs das Dokument von der Website löscht, sind die Rechte auch weg. NFT sind nicht dafür geeignet, sinnvoll damit etwas zu machen. Aber NFT kollabieren gerade, weil offensichtlich die Blase geplatzt ist.
4. Blockchains machen Transaktionen transparent. Also kann niemand mehr betrügen.
Ja, Blockchains machen Transaktionen transparent. Dass dort niemand mehr betrügen kann, ist eine sehr enge Definition von Betrügen.
Blockchains garantieren Konsistenz. Ich kann nicht, wenn ich einen Bitcoin habe, zwei ausgeben. Das ist das Double-Spending-Problem, das die Blockchain sehr zuverlässig und robust löst. In der Interaktion mit der echten Welt ist das aber meist nicht das größte Problem.
Betrug sind nicht nur gefälschte Bücher, sondern auch, dass ich falsche Dinge vortäusche und in die Chain schreibe. Falsche Daten auf eine Blockchain zu bringen ist zwar bei Bitcoin nur schwer möglich, bei vielen anderen Projekten aber sehr leicht. Genauso einfach ist, es Leute dazu zu bringen, auf einen falschen Link zu klicken, um damit alle ihre Token zu klauen. Hier wird ein kleines Problem – das Double-Spending-Problem – gelöst, dafür werden aber viele neue, größere Probleme geschaffen.
5. Das Metaverse und das Web3 hängen zusammen.
Das stimmt nicht. Es sind zwei sehr wackelige Ideenkartenhäuser, die irgendetwas mit Zukunft zu tun haben. Und weil sie zusammen gedacht werden, sollen sie stärker sein. Aber nichts davon hält einem genauen Blick Stand.
Facebook kann immer noch nicht erklären, was das Metaverse sein soll – abgesehen von cringe 90er-Jahre-VR-Chats. So richtig erklärbar ist das Metaverse also nicht und wenn, dann scheint es sehr doof zu sein. Außerdem steht das zentralisierte Metaverse von Facebook im Gegensatz zu der angeblich so dezentralen Web3-Welt.
Aber das Metaverse und das Web3 verweisen gegenseitig aufeinander. Das eine scheint relevant zu sein, weil es das jeweils andere gibt. Digitale Assets verkaufen wir in Videospielen seit Jahren. Ownership in digitalen Spaces ist also nicht neu.
Das Metaverse als krude Idee der Reimplementierung der physischen Welt ist eine sehr retro-undigitale Sichtweise. Das Metaverse und das Web3 sind zwei schwach ausdifferenzierte Narrative, die davon leben, dass sie aufeinander aufbauen. Nichts davon ergibt technisch oder fachlich Sinn. Das wird in kurzer Zeit aufgelöst werden.
6. Kryptowährungen haben momentan ein Problem mit hohem Energieverbrauch, aber kommende Updates werden das beheben.
Seit sechs Jahren will Ethereum als zweitgrößte Chain von Proof-of-Work zum Konsensmechanismus Proof-of-Stake wechseln. Der angebliche Wechsel ist das Totschlagargument für die hohe Energiebilanz und den Elektroschrott, der durch das Mining verursacht wird.
Immer wenn man fragt, passiert der Wechsel in ein paar Monaten. Durchgeführt wird er dann aber nie. Ist auch klar, weil keiner der Miner monetär etwas davon hätte. Dieses Verschieben auf die Zukunft ist ein Problem des Web3. Doch das Energieproblem haben wir schon in der Gegenwart.